2025/07/02
Tagebuch 1974, Teil 82: Lampang (Thailand)
von Dr. Christian G. Pätzold
"Helping Thailand grow"
und der Bundesrepublik Deutschland.
Aus der "Bangkok Post" vom 10. Februar 1974.
DED: 39 Volunteers in Thailand.
30. Januar 1974, Lampang, Mittwoch
Heute haben wir die "Universal Fruit Company" in Lampang besucht, die Konserven aller Sorten herstellte und zu 90 Prozent exportierte. Es arbeiteten zirka 400 Arbeiterinnen, meist jüngere Mädchen, in einer modernen Fabrikhalle mit Berieselungsmusik. Gerade wurden Champignons gewaschen und verpackt, die auf dem Firmengelände gezüchtet wurden. Die Champignonzucht sollte die einzige Anlage in Thailand sein und deswegen top secret. Die Mädchen in der Konservenfabrik verdienten 8 Baht (1,10 DM) pro Tag.
Abends waren wir bei einem amerikanischen Peace Corpsler aus Loveland/Colorado zum Essen eingeladen, der Englisch unterrichtete. Er hatte einen thailändischen Freund, einen ehemaligen Boxer, mit dem er in die USA zurückfahren wollte. Wir haben über die Afroamerikaner gesprochen, da ich gerade Eldridge Cleavers Buch "Soul on Ice" gelesen hatte, eine Autobiografie und gleichzeitig ein berühmter Basistext des Black Power Movement in den USA.
31. Januar 1974, Lampang, Donnerstag
Tagsüber haben wir im Haus gelesen. Abends sind wir zu einem Burmesischen Tempel gegangen, wo uns die Mönche aus Burma, teils Neuzugänge, ihr Wat zeigen wollten. Die burmesischen Mönche hatten bessere Englischkenntnisse als die thailändischen Mönche. Ein alter Mönch, wahrscheinlich der Oberbonze, mit Hörgerät und Brille und mit ganz dicken und langen Ohrläppchen, sprach ganz britisches Englisch. Er sagte, unter der Herrschaft der Engländer sei es in Burma noch gut gewesen, aber jetzt gehe alles abwärts: "They have a new Government, they call it social." Social war ihm ein Horror. Einer amerikanischen Touristin hat er die Wandmalereien gezeigt, auf denen auch ein altertümliches Auto abgebildet war. Ein anderer Mönch sammelte Geld von den Touristen. Er wollte wissen, wie viel 1.000 Lire wert waren. Leider mussten wir ihm sagen, dass sein italienischer Geldschein nicht so viel wert war (1.000 Lire entsprachen 4 DM).
1. Februar 1974, Lampang - Chiang Mai, Freitag
Vormittags sind wir mit dem Taxi für 20 Baht (3 DM) nach Chiang Mai gefahren. Im Muong Thong Guest House sind wir für 30 Baht (4,50 DM) für die Übernachtung abgestiegen. Zuerst haben wir uns die Choleraspritze abgeholt, aber der Mann zum Unterschreiben im Impfpass war nicht da, so dass wir noch mal wiederkommen mussten. Danach waren wir im Burmesischen Konsulat, wo wir ein Visum für Burma beantragt und bekommen haben, da wir überlegt hatten, vielleicht noch Burma zu besuchen (was sich dann aber nicht realisiert hat). Der Konsulatsbeamte war sehr gesprächig und wir haben uns über Gott und die Energiekrise, Transportprobleme und die Gerechtigkeit auf Erden unterhalten. Er meinte, man solle die Menschen in Atome verwandeln und als Wellen zum Empfänger schicken, wo sie zurückverwandelt würden. Der burmesische Konsulatsbeamte kannte sich offensichtlich mit Science Fiction aus.
Wir waren noch in einem Shop mit lokalen Kunstgegenständen, Holzfiguren mit Blattgold, Quarzschnitzereien, Silberplatten und Silberbecher.
© Dr. Christian G. Pätzold, Juli 2025.
Zum Anfang
2025/06/30
Zum Anfang
2025/06/26
Reinhild Paarmann
Nachwort zur China-Reise 1994
Als wir im Herbst 1994 China vom Norden bis Süden bereisten, war die Reform- und Öffnungspolitik Deng Xiaopings gerade zwei Jahre her. Einen Eindruck bekamen wir davon, als wir die besondere Wirtschaftszone Zhuhai am Südchinesischen Meer, das waren die kapitalistisch orientierten Reformgebiete, besuchten, ein riesiges Areal von Bürohochhäuser-Firmen. Dominierten auf den Straßen von Xian im Norden noch Massen von Fahrrädern auf den Straßen, so schien hier die Welt so kapitalistisch wie bei uns. Damit begann der rasante wirtschaftliche Aufstieg Chinas vom armen Bauernstaat zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht hinter den USA innerhalb von 30 Jahren und zu einem mächtigen Spieler auf der Weltbühne. Maos Kommunismus wurde aufgegeben und ein westlich orientiertes Marktwirtschaftssystem eingeführt, was soziale und wirtschaftliche Ungleichheit zur Folge hatte. Eine wirtschaftliche Elite mit enormem Reichtum entstand. Chinesische Waren sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aus der Werkbank der Welt ist inzwischen ein Hightech-Land geworden.
Wir haben diese Entwicklung seitdem interessiert verfolgt und unternahmen noch später zwei Tibet-Reisen, zuletzt 2018. Lhasa erschien uns wie eine westliche Sightseeing-Metropole. Eine Eisenbahnlinie verbindet heute Peking mit Lhasa.
An der Freien Universität Berlin nahmen wir u. a. am Seminar "Von der Großen Mauer zum Pekinger Kaiserhof" teil, das ein chinesischer Gastdozent abhielt. Ein anderes Seminar über: "Die Rezeption chinesischer Philosophie in Europa" und "Als Christus Konfuzius und Buddha traf". Dabei erfuhren wir, dass die regierende KP Chinas zunehmend die Lehre des Konfuzius, die die Stellung des Einzelnen zum Staat mit Pflichten zu Gehorsam und moralischem Handeln in Verbindung bringt, vor der nicht mehr zeitgemäßen marxistisch-kommunistischen Doktrin bevorzugt.
Insgesamt erlebten wir auch im universitären Bereich unserer Gasthörerschaft die Öffnung Chinas im wissenschaftlichen Austausch. So gibt es auch das Konfuzius-Institut bei der FU. Viele chinesische Student/innen sind an der FU. Chinesische Autor/innen haben bei uns erfolgreich eine große Leserschaft, wie z.B. Can Xue, Ma Yuan, Mo Yan.
Die VR China ist zum großen Rivalen der USA in der Geopolitik aufgestiegen. Die Politik von Staatspräsident Xi Jin ping hat die nationale Größe und die Interessen Chinas im Mittelpunkt. Es geht um Einflusssphären, Bodenschätze, Ressourcen, geostrategische Vorteile, ein Beispiel das Projekt "Neue Seidenstraße". Von der weiteren strategischen, geopolitischen Konstellation wird es abhängen, ob die beiden Rivalen in der Zukunft friedlich auskommen.
© Reinhild Paarmann, Juni 2025.
Zum Anfang
2025/06/22
Reinhild Paarmann
Reisebericht China 1994, Teil 6
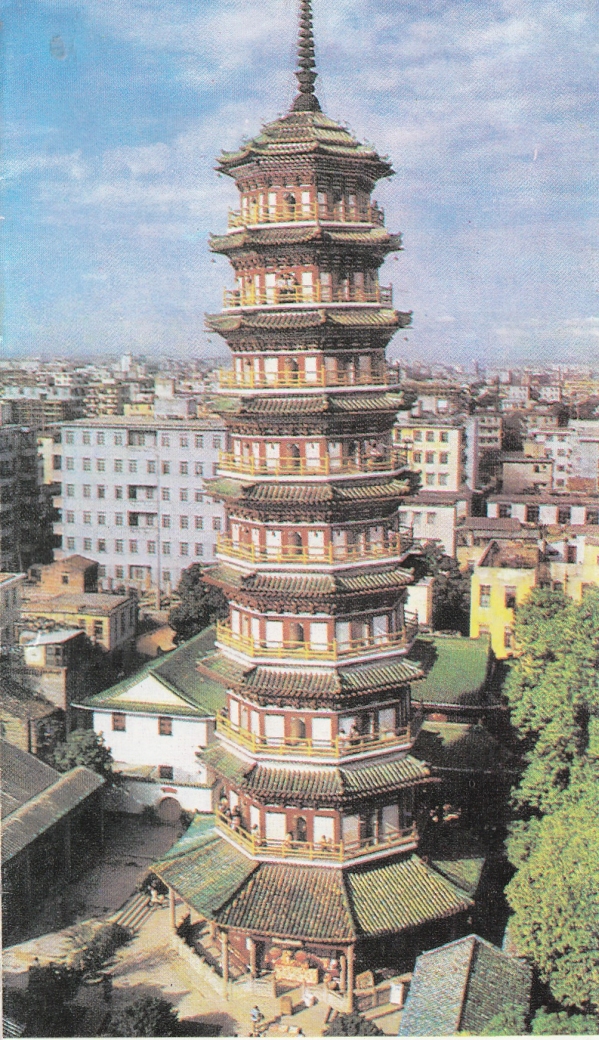
Im Flugzeug erhalte ich gesalzene Pflaumen. Ich koste und spucke sie gleich aus.
Unsere Reisegruppe landet in Kanton. Wir besuchen den Ahnentempel der Familie Chen. Mein Mann wird so aufgeregt, wie an der Chinesischen Mauer. Hier hat er schon mal gelebt. Ich möchte mich am liebsten ausruhen, aber er hat den unstillbaren Drang, durch die Gegend zu ziehen. So überwinde ich mich.
Ein Mann schläft auf einer Zeitung auf der Straße. Eine Schweinehälfte wird auf einem Motorrad transportiert.
In einem Tempel steht eine Teekanne mit einem Ast-Henkel und der Tülle aus Holz. Ein Fischernetz aus Elfenbein geschnitzt hängt da. Ein Buch aus dem gleichen Material. Andere Bücher aus Kamelknochen.
Der Liurong-Tempel mit der Blumenpagode ist ein buddhistisches Heiligtum von 9 Stockwerken, das dem Zen-Buddhismus nahe steht. Blinde spielen Musikinstrumente. Große Banyan-Bäume. Ein Mann verbrennt in einem Metalleimer Räucherwerk. Die Säulen des Tempels sind rot. Wir steigen auf die Pagode, denn das soll ein besseres Leben bewirken. Mein Mann hat "seinen" Ort gefunden. Zum Andenken nimmt er eine ockerfarbene, glasierte alte Scherbe vom Boden auf und nimmt sie mit.
Wir gehen aus dem Tempel. An einem Bahnübergang sehe ich eine blaue Ampel. Was diese Farbe wohl zu bedeuten hat? Ich habe in China gelernt, dass hier fast nichts zufällig ist. Ein Glück, dass ich an diesem Ort nicht Auto fahren muss. Der Verkehr kommt mir chaotisch vor.
"1000-Buddha-Pagode": Ahnentafeln mit Fotos. Die rote Farbe am Bild bedeutet, dass der Abgelichtete im nächsten Leben Beamter werden soll. Eine gelbe Tafel mit roter Farbe heißt, dass der Ehepartner schon längst gestorben ist. Unter den Bildern wird geopfert. Gläubige holen dafür Geschirr unter einem Vorhang hervor.
Kinder sammeln auf der Straße für Kinder, die auf dem Land leben und aus finanziellen Gründen nicht zur Schule gehen können.
Wir besuchen den Tiermarkt. Gezüchtete Hunde sitzen in Käfigen neben Katzen. Tote, gerollte Schlangen sehen aus wie Lakritze. Tote Fledermäuse kann man kaufen, lebende Tausendfüßler und Schildkröten, Aal-Eier und Hundepfoten. Hier isst man alles, was kreucht und fleucht. Im Restaurant werden essbare Nudel-Sprossen-Körbe mit Gemüse gefüllt und Fleisch dazu angeboten. Am Perlfluss genießen wir den Sonnenuntergang.
Am nächsten Morgen sehen wir im Hotel ein Mädchen im Baströckchen und einer Plastikblume im Haar. Wir fahren mit unserem Reisebus nach Zhongshan zum Haus von Sun Yat-sen. Nach der Besichtigung geht es weiter durch die fruchtbare südchinesische Landschaft bis Zhuhai. Die Hafenstadt am Südchinesischen Meer ist eine Sonderwirtschaftszone, die 1992 nach der Wirtschaftsreform von Deng Xiaoping geschaffen wurde.
Ein Jude, das Käppchen mit einem Lockenwickler-Clip befestigt, geht vorbei.
Vor den Häusern sind vergitterte Fenster als Schutz vor Einbrechern. Wir übernachten in einem schmucklos nüchternen Hotelturm, überall fast die gleichen wie aus dem Boden geschossenen Bürotürme.
Mein Mann wird darauf hingewiesen, dass nachts wahrscheinlich öfter das Telefon klingeln wird. Prostituierte werden ihre Dienste anbieten. Tatsächlich klingelt das Telefon in dieser Nacht oft. Ich nehme den Hörer ab und melde mich. Das scheint die Anruferinnen nicht zu stören. Chinesinnen fahren auch nach Macao, um sich dort in ihrem Gewerbe zu betätigen. Sie werden nicht kontrolliert, da es den Beruf offiziell nicht gibt.
Wenn man heiraten möchte, muss man seinen Arbeitgeber fragen, der insgeheim von den Partei-Funktionären "Dicke Katze" genannt wird. Man kann Wohnungen zum Eigenbedarf kaufen. Viele davon stehen leer, da es nur wenige gibt, die sie sich leisten können.
In Süd-China leben viele "Zweitkinder" illegal, weil sich deren Eltern die Strafe, die sie für ein 2. Kind zahlen müssen, nicht leisten können. Mit 55 Jahren kann eine Frau, mit 60 Jahren ein Mann in Rente gehen. Bevor man das erste Mal Urlaub bekommt, muss man sieben Jahre gearbeitet haben.
Grüne Nummernschilder an Autos bedeuten, dass dies Fahrzeuge eines Regierungsbeamten sind. Private Autos haben schwarze Nummernschilder wie auch die von ausländischen Investoren. Rote Nummernschilder tragen Autos der volkseigenen Betriebe. Polizeiautos haben weiße Nummernschilder. Aus Hongkong gestohlene Autos verwenden Polizisten als Dienstwagen. 27 % beträgt die Auto-Importsteuer. Neue Autos (chinesische Volkswagen) sind mit grauen Nummernschildern ausgestattet. Zum Händewaschen wird ein Behälter mit Teewasser gereicht. Im Hotel sehen wir ein Modellgebirge mit Wasserfall in Miniaturformat und künstlichem Nebel. Vor 10 Jahren galt als besondere Attraktion in der Familie des Reiseleiters ein Ventilator. Nachbarn kamen, um ihn sich auszuleihen. Es gibt viele Flüchtlinge, die ein zweites Kind haben, das weder in einen Kindergarten noch in eine Schule darf, denn dazu wäre eine Aufenthaltsgenehmigung notwendig. Diese erhält man nur an dem Ort, an dem man geboren wurde. Dort soll man sein Leben verbringen.
Von der Regierung wird jedem Menschen Arbeit zugeteilt. Wenn man in der "Sonderwirtschaftszone" Geld verdienen will, braucht man eine Erlaubnis. Chinesen, die bei ausländischen Firmen arbeiten, benötigen diese nicht. Der ausländische Arbeitgeber kann ihnen aber keine Wohnung anbieten. Auf dem Schwarzmarkt werden Aufenthaltsgenehmigungen angeboten. Dort gibt es auch BRD-Pässe oder Mercedes-Busse. Die Regierung ist zum Teil korrupt. Ich sehe die Werbung: "Tolle Glühbirnen aus Deutschland - Osram." Über einem Restaurant steht "Berühmter Hundefleischeintopf".
Die Chinesen schlafen im Sommer nachts auf Bambusmatten. Beim Mittagschlaf liegen sie auf harten Bambuskissen.
Die Schüler sind brav, denn sie haben Angst vor ihren Lehrern. Als die Reiseleiterin einmal eine Grundschule besuchte, mussten die Kinder die Hände auf dem Rücken halten und so sitzen.
Ausländische Studenten wohnen nicht da, wo die chinesischen leben. Zwischen ihnen ist ein Zaun. Wenn ein Dozent einen Studenten besucht, muss er aufschreiben, wann er gekommen und gegangen ist. Heute spielen die Aufnahmeprüfungen nicht mehr so eine große Rolle. Wenn man Geld hat, kann man sich bessere Zensuren "kaufen". Nach dem Studium muss man fünf Jahre lang arbeiten. Ob man studieren darf, entscheidet das Geld, das man besitzt und die guten Noten. Früher ging es nur um die guten Zensuren.
Ich sehe einen Baum mit lila Blüten.
Foshan: Wenn man ein rotes Tuch um ein Handgelenk bindet, kann man Unglück vermeiden, glaubt man hier.
Vor zehn Jahren hatten die Mädchen drei Ansprüche an einen Mann, den sie heiraten wollten: Er musste eine Uhr, ein Fahrrad und einen elektrischen Ventilator haben. Heute verlangen sie schon eine komplette Wohnung mit allem Komfort, eine Videokamera und ein Moped oder Auto. Die Hochzeitsfeier bezahlt der Mann außerdem. Vor 50 Jahren wurden die Ehen noch von den Eltern arrangiert. 80 % der jungen Leute können heute sich selbst den Partner wählen.
Im Ahnentempel "Foshan Zumiao": Ein Mann wirft eine Münze nach einer Figur des "Nördlichen Gottes". Der Kaiser trägt einen "Heiligenschein". Der Kopf ist an der Stirn platt abgeschnitten. Eine Steinschildkröte mit einer Schlange liegt im See. Man soll ihr eine Münze auf den Rücken werfen, wenn diese da liegen bleibt, hat man Glück. Ich schaffe es.
© Reinhild Paarmann, Juni 2025.
Zum Anfang
2025/06/18
Reinhild Paarmann
Reisebericht China 1994, Teil 5

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.
Am nächsten Tag erreichen wir nach fünfstündiger Fahrt mit dem Zug durch das Jangtse-Tal Shanghai.
Eine Frau aus der Reisegruppe lebte 1950 hier. Ihr Mann besaß eine Fabrik, die Indigo für die blauen Mao-Uniformen verkaufte. Die Amerikaner hatten die Fabrik zerstört. Wie kam sie nach Shanghai? Erst arbeitete sie als Kindermädchen in Hongkong. Als Deutsche wurde sie von den Engländern ausgewiesen, nachdem ihr Heimatland England den Krieg erklärte. Da ging sie nach Shanghai. Dort lernte sie ihren späteren Mann, einen Deutschen, kennen.
Wir sitzen an einem See, Bäume säumen ihn, aus denen Fledermäuse fliegen, die ihre Kreise ziehen. Sie sollen Glück bringen. Wir bummeln auf der berühmten Nanjing-Route mit den großen Kaufhäusern.
Auf vielen Baustellen arbeiten auch Frauen. Eine davon trägt einen orangen Helm.
Wir besuchen den "Jade-Buddha-Tempel". 108 Kugeln hat die Gebetskette der Buddhisten. Sie symbolisieren alle Sorgen der Welt. Der Jade-Buddha sollte in der Kulturrevolution zerschlagen werden. Ein Mönch legte ihm eine Mao-Bibel in die eine Hand, so wurde er verschont. Mit einem Holzstock, an dem zwei Zinken sind, werden die Pantoffeln eingesammelt. Zum Jade-Buddha, aus feinster, weißer Jade, darf man nur in Pantoffeln. Ich sehe drei Buddhas mit Igelhaaren.
Die andere Frau, die in den Dreißigern in Shanghai lebte, erkennt die ehemalige Pferdebahn wieder. Wir sind am Bund, an der Uferpromenade mit prächtigen Geschäfts- und Hotelgebäuden vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Pferdebahn ist jetzt ein Volkspark. Vor dem Park stand ein Schild: "Für Chinesen und Hunde verboten". Ich erinnere mich an einen Karatefilm, in dem dieses Schild gezeigt wurde. Als der Karatekämpfer Bruce Lee es sah, rastete er aus. Nach dem Krieg gab es ein neues Schild: "Für Deutsche und Hunde verboten!" Engländer und andere Ausländer verbrachten damals ihre Freizeit hier. Sie spielten Kricket und gingen schwimmen. Zu dieser Zeit waren die Verkehrspolizisten Sikhs. Auch sie spielten gern Kricket und nahmen dafür sogar ihren Turban ab, sodass der Haarknoten zu sehen war. Daneben lagen die Bibliothek und der Klub der jungen, christlichen Männer. In der Tibet-Straße ging 1937 eine Bombe hoch. Die Eltern von der Frau aus unserer Reisegruppe, die sich zu dieser Zeit dort aufhielten, schrieben das ihrer Tochter, die gerade eine Schule in Europa besuchte.
Im 14. Stock eines Hauses war das Restaurant, in dem sie sich mit einer Freundin, die hier eine Weile lebte, traf. Sie aßen zusammen und gingen zu Tanzveranstaltungen. Ein Jahr besuchte sie in Shanghai eine deutsche Schule. Die Bäume an der Rennbahn pflanzten Kommunisten. Das alte Rathaus wollten die Engländer wieder haben. Es wurde zerstört. Ein neues wird jetzt gebaut.
Die Verkehrspolizisten müssen im Monat 2.500 Strafgelder ihrem Chef abgeben, den Rest dürfen sie behalten. Deshalb sind sie hier besonders eifrig. Die Frau erzählt, dass der Ortsgruppenleiter der NSDAP damals ihren Vater warnte, da die Familie einen jüdischen Zahnarzt hatte. Sieben Jahre wohnten sie hier.
In einem Karaoke-Restaurant stecken sich Neuseeländer Servietten in die Ohren, als ein Chinese englische Schlager zu singen beginnt.
Ich träume, dass "Hanu" die Sprache der Götter sei und daher die Han-Chinesen ihren Namen haben.
Wenn man ein Fahrrad kaufen will, muss man sein altes abgeben. Es gäbe hier zu viele Fahrräder. Einige Straßen sind für Fahrräder gesperrt. Wir sehen schlafende Bauarbeiter auf dem Gehweg mit Helmen und Gummistiefeln. Ein Mann geht mit seinem Papagei spazieren. Er hat eine Schirmmütze aus Peddigrohr. Sechsmal am Tag werden hier die Straßen gefegt. Verkehrspolizisten stehen unter einem Sonnenschirm.
In der Grund- und Mittelschule müssen zwei Kinder auf einem Stuhl sitzen. In der Oberschule dürfen Mädchen und Jungen nicht mehr zusammen auf einem Stuhl sitzen, erzählt der Reiseleiter.
Im "Yu-Garten": Hier befindet sich ein Stein mit 72 Löchern. Wenn man in diese unten Räucherstäbchen reinsteckt, gibt es überall die Duftschwaden. Wasser fließt von oben durch alle Löcher, denn sie sind miteinander verbunden.
Ich bewege eine Kugel in einem Löwenmaul, denn das soll Glück bringen. Der Löwe steht für Macht.
In Shanghai existierte auch ein Judenviertel. Es war der letzte Zufluchtsort deutscher Juden nach dem November-Pogrom 1938. Fast alle Bewohner hatten kein fließendes Wasser. Die Frau erinnert sich, dass sie ein deutsches Kindermädchen kannte, das hier wohnte. Diese arbeitete mit französischer Konzession und musste jeden Abend nach Hause zurück. Während der japanischen Besatzung machten die Japaner auch bei ihnen eine Hausdurchsuchung. Die Emigranten strickten damals Pullover und Handschuhe, um Geld zu verdienen.
Ich sehe Wäsche auf Stangen zum Trocknen vor den Häusern. Durch das Hosenbein oder durch einen Ärmel ist die Stange gezogen.
Die Inflationsrate beträgt zurzeit 20 %. Kinder mit roten Tüchern sind Pioniere und Grundschüler. Wer nicht mitmacht, ist "out".
Der Tee im Restaurant schmeckt so nach Chlor, dass man ihn fast nicht trinken kann. Wir essen "Tofu der pockennarbigen Mutter". Prostitution ist zwar verboten, sie gibt es aber trotzdem.
Die Hafenrundfahrt auf dem Huangpu-Fluss ist eine Enttäuschung, denn durch den Smog sieht man fast nichts. Ich suche den Ort, an dem das "Hotel Shanghai" von Vicky Baum mal stand. 1937 wurde es von einer japanischen Bombe zerstört. Ob man es wieder aufgebaut hat? Das Bombardement der Japaner auf Shanghai wird auch in "Sturm über Shanghai" von Robert S. Elegant beschrieben. Am Rande des Internationalen Settlements von Shanghai sieht man die Armut und die Straßenkinder, wie sie von E. F. Lewis in "Shanghai 41" beschrieben wurden. Wo finde ich die spannenden Geschichten wieder? Sie sind Vergangenheit und stammen aus den Kriegszeiten. Zum Glück ist es jetzt ruhiger hier. Shanghai kann mich nicht begeistern. Allen Touristen soll es so gehen wie mir.
Wir fliegen nach Guilin und erhalten im Flugzeug Litschi-Saft. Den Wasserkastanien-Saft von der Reiseleitung habe ich gekostet, konnte aber kein Gefallen daran finden, ganz im Gegensatz zum Litschi-Saft. Wir fliegen in einer Maschine mit einem katastrophalen Druckausgleich. Meine Ohren scheinen zu bersten. Aber Guilin entschädigt für die Schmerzen. Wir bummeln auf der Sun-Yat-Sen-Straße, der Einkaufsstraße von Guilin. Kampferbäume stehen am Straßenrand. Es gibt Osmanthus-Tee, der nach Zimt duftet und schmeckt. Wein kann man kaufen und "Drei Blüten-Schnaps". 28 Grad herrschen hier! Endlich Wärme. Ethnische Minderheiten leben an diesem Ort. Eine davon hat folgenden Brauch: Wenn ein Mädchen sich in einen Jungen verliebt, wirft es ihm beim Tanz einen Seidenball zu. Wenn er ihn behält, dann ist er auch in es verliebt, wenn nicht, wirft er ihm den Ball zurück. "Fensterln" ist hier üblich. Das Mädchen lässt das Fenster im 1. Stock zu ihrem Zimmer offen, der Junge klettert da hoch und rein.
Friseure sieht man auf der Straße. Schlangen kann man essen und in Form eines Schnapses trinken. Letzteres ist Medizin. Rattenschnaps bringt langes Leben. Hunde werden zu Reisnudeln gegessen. Ein kleines Kind läuft auf Schienen, seine Eltern hinterher. Eine Bürgermeisterin führt hier die Amtsgeschäfte. Das Schriftzeichen für Frau ist eine Knieende; diesem Symbol wurde der Kampf angesagt. Die Großmutter der Reiseleiterin, die wir hier haben, durfte nicht zur Schule gehen. Sie hat das Lesen von ihrer Tochter gelernt. Sie verwendet noch heute kein Geld, weil sie nicht versteht, wozu man das braucht.
In der "Schilfrohrflötenhöhle": Früher gab es hier viel Schilfrohr, deshalb der Name. Die Leute retteten sich damals in die Höhle bei Naturkatastrophen. Jede Formation der angestrahlten Stalaktiten hat einen besonderen Namen wie "Morgenröte über einer Horde von Löwen", "Herabstürzender Wasserfall", "Lachender Buddha", die Chinesen sehen in Steinen einen alten Mann, der Pilze sammelt, eine Drachenpagode, Lotosblume, einen Blumenkohl, Chinakohl, Ginseng-Wurzeln, das bedeutet langes Leben, ein alter Mann klettert einen Berg hinauf, um einen Ginseng zu holen. Ein Affenkönig wird gefunden, eine goldene Brücke wollte er aus den Felsen machen, der Drachenkönig weigerte sich, die Steine zu geben; Fische, Schnecken, Seemuscheln, die nach dem Tod versteinerten. Eine Sonnenblume, ein alter Mann mit seinen Enkelkindern, Elefanten tanzen zu Flötenmusik, ein Affe hört zu, vergisst dadurch, seine Banane zu fressen. Da ist ein Spiegel, dort ein altes Gespenst, Tausendfüßler, Löwe und ein Theatervorhang. Ein Mädchen will zur Schule gehen und verkleidet sich als Junge. Da lernt sie in der Klasse einen Jungen kennen. Sie treffen sich heimlich, denn er merkt bald, dass sie ein Mädchen ist. Da sie nicht heiraten können, begehen sie zusammen Selbstmord. Ein Frosch hockt an der Felsenwand, ein Perlenfisch dazu. Der Elefantenrüsselberg, der am Zusammenfluss des Taohua Jiang und des Li Jiang liegt, ähnelt einem Elefanten beim Wassertrinken. Ein Händler steht mit einem Lautsprecher da.
Eine Händlerin rennt einem Mann aus der Reisegruppe hinterher, als wir die Höhle mit ihren Geschichten verlassen. Sie will Geld von ihm. Andere Händler kommen dazu, um die Kollegin zu unterstützen. Der Reiseleiter gibt dem Händler etwas Geld, dann braust der Bus davon. Die Situation war bedrohlich. Der Mann erzählt, dass er eine Waage kaufte. Die Händlerin habe ihm falsches Geld herausgegeben. Da wollte er die Waage nicht mehr. Sie behauptete nun, er habe etwas gekauft und nicht bezahlt.
Der Reiseleiter erzählt eine Legende: Ein Elefant begleitete den Kaiser, wurde krank und von ihm im Stich gelassen. Ein Bauer pflegte ihn. Da kam ein Soldat, der den Elefanten tötete. Er versteinerte.
Zum Li-Fluss gibt es auch eine Geschichte: Der Drachenpalast liegt im Meer, denn früher war hier Wasser. Da wohnte der Drachenkönig mit seiner Tochter. Der Kaiser wollte eine Mauer bauen, darum trieb er die Berge mit einer Peitsche ins Meer. Das Mädchen sah dadurch die Existenz ihres Vaters und ihre eigene gefährdet. Sie bezirzte den Kaiser und nahm ihm die Peitsche weg. Dann schuf sie als Kompromiss den Li-Fluss. Er wurde "Sonnen-Fluss" genannt, nach dem Namen des Mädchens. An diesem Ort soll das Mädchen begraben sein.
Ein Wasserbüffel spaziert auf der Straße. Hier wurde ein biologischer Dünger entwickelt für 58 Gemüsesorten. Er wird auch aus der dalmatischen Insektenblume gewonnen.
Von 1958 bis 1978 wurde in Kommunen gearbeitet. Dann kam die Bodenreform. Jeder Bauer erhielt ein Mu (15 Mu sind ein Hektar) Land. 16 % muss er von der Ernte an den Staat abliefern. Die Frauen arbeiten auf dem Feld, die Männer in der Stadt. Die Kinder helfen den Müttern. Die Bauern auf dem Land werden in der Klinik kostenlos behandelt, aber in der Stadt müssen sie bezahlen. In der Stadt gibt es eine Krankenversicherung für Beamte und Angestellte (50 % der Beträge müssen die Arbeitnehmer zahlen). In der Klinik wurde früher kein Essen ausgegeben, die Kranken brachten ihre Diener mit, die auf dem Flur kochten.
Eine Sperre liegt auf den Schienen, Reis, der zum Trocknen ausgelegt ist, wird gerade zusammengerecht, wie ich aus dem Bus heraus sehe. Maniok wächst hier. Die Wurzel ist giftig. Sie wird eine Woche ins Wasser gelegt, dann kann man sie essen.
Wir sehen Soldaten. Der Militärdienst ist in China freiwillig. Er ist sehr beliebt, weil man anschließend gute Berufsaussichten hat.
Ein Berg sieht aus wie etwas zwischen einer Ziege und einem Wasserbüffel. Ein Fabel-Wesen soll so ausgesehen haben. Es gibt auch Ringe in dieser Form aus Elfenbein. Sie sind den Frauen vorbehalten und bringen Fruchtbarkeit.
Zum Totenfest am 5.4. wird zu den Grabsteinen Essen gebracht und Papiergeld verbrannt. Die Reiseleiterin erzählt von den Tierkreiszeichen der Chinesen, die alle sieben Jahre sich wiederholen. Ich bin im Jahr des Affen geboren. Aber die Charakteristika dafür passen nicht so gut auf mich, wie auch die anderen Reisenden sich in ihren Tierkreiszeichen nicht unbedingt wieder erkennen. Aber wir wurden auch nicht in China geboren!
Die Fahrt mit dem Boot auf dem Lijiang-Fluss durch die berühmte Kegel-Karst-Landschaft mit ihren bizarren Formationen ist die schönste, die wir bisher in China gesehen haben. Wenige Touristen sind unterwegs. Zum Essen werden auf dem Schiff gebratene Vögel und Tofu-Haut serviert.
Später steigen wir auf den "Wellenberg", der 325 Stufen hat. Dort oben hat man eine schöne Aussicht. Auf dem Felsen daneben klettern Touristen. Unten liegt eine kleine Höhle, die "Zurückgegebene Perle" heißt. Ein kleines Kind spielte einmal dort. In der Höhle schenkte ein Mann dem Kind eine Perle. Als das Kind mit der Perle nach Hause kam, sagten seine Eltern, es müsse die Perle zurückbringen. Das Kind gehorchte.
Schuhe hängen an einer Hauswand, die Sohlen nach oben. Die Toilettenfrau greift mich tätlich an, als ich ihr drei Mao gebe, wie der Reiseleiter mir riet. Das Trinkgeld landet auf dem Boden.
Eine Gemüsefrau schenkt einem Bettler eine alte Banane. Ein Chinese spricht mich in Englisch an und erzählt mir wie aufgezogen seine Lebensgeschichte. Er wäre in Hongkong gewesen, als die Japaner die Chinesen angriffen. Zeitweise habe er in San Francisco in Chinatown gelebt. Als der Vater dort starb, kehrte er nach China zurück. Er heiße David. Ich sehe, dass er nur noch einen Zahn hat.
Die Reisegruppe besucht eine Klinik, in der man sich kostenlos durch eine Elektrotherapie behandeln lassen kann. Der Meister, der diese Therapie seit 15 Jahren ausübt, lädt sich mit Kung-Fu-Bewegungen energetisch auf und kann dann 220 in 25 Volt verwandeln. Ein Phasenprüfer, der anzeigt, ob an einer Stelle Strom fließt, den er an seine Stirn hält, leuchtet auf. Er nimmt die Hand eines Kollegen, der wiederum einen weiteren berührt, bis der Kreis mit acht Mitarbeitern sich beim Kung-Fu-Meister schließt, der dadurch eine Glühbirne zum Leuchten bringt. Ich stelle mich für eine Einzelbehandlung zur Verfügung, denn ich habe mich durch die Klimaanlage im Hotel und in den Restaurants erkältet. Der Meister fegt mein Fieber vom Kopf. Als er auf meine Ohren drückt, die seit dem Flug nach Guilin schmerzen, tut es weh. Nach 10-minütiger Behandlung sind meine Beschwerden verschwunden.
Andere in der Gruppe lassen sich gegen Rheuma behandeln. Homöopathische Medikamente, die hier hergestellt wurden, kann man kaufen. Sie werden nach Rezepten von alten Bauern zubereitet und sind sehr teuer. Die Zusammensetzung der Medizin wird nicht verraten und von Generation zu Generation vererbt. Ich erwerbe für eine Bekannte ein Rheuma-Mittel, das 200,- DM kostet. Ich kaufe mir prophylaktisch ein Mittel gegen Halsschmerzen, das nach Schimmel schmeckt und mir Brechreiz beschert.
Nachts besucht unsere Reisegruppe die Kormoranfischer. Diese Vögel können in der Dunkelheit sehen. Ein Kormoran ernährt mit seinen Fängen eine ganze Familie. Mit 3-4 Monaten lernen die Kormorane ihrem Herrn zu gehorchen. Dazu werden sie von ihren Metallketten losgebunden und ins Wasser geworfen. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Wenn sie ihre Beute nicht loslassen, werden sie mit einem Stock auf den Kopf geschlagen. Am Hals steckt ein Spieß, der reingedrückt wird, falls sie immer noch nicht den Fisch freigeben. Fliegen sie nicht sofort nach dem Fang zu ihrem Herrn zurück, werden sie mit einer Schnur an einem Stock eingefangen. Wenn sie genügend Fische für ihren Besitzer gefangen haben, dürften sie sich selbst sättigen.
Der Reiseleiter erzählt, dass in Guilin ein damals 10-jähriges Mädchen lebte, die in diesem Alter ihr erstes Buch schrieb, denn sie kann gut dichten und malen. Mit ihrem Buch flog sie nach Japan und schenkte dem Kaiser ein Exemplar. Als vor 2-3 Jahren hier eine Überschwemmung war, hat sie ihre Bücher verkauft und den Erlös den Opfern gespendet.
© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.
Zum Anfang
2025/06/14
Reinhild Paarmann
Reisebericht China 1994, Teil 4
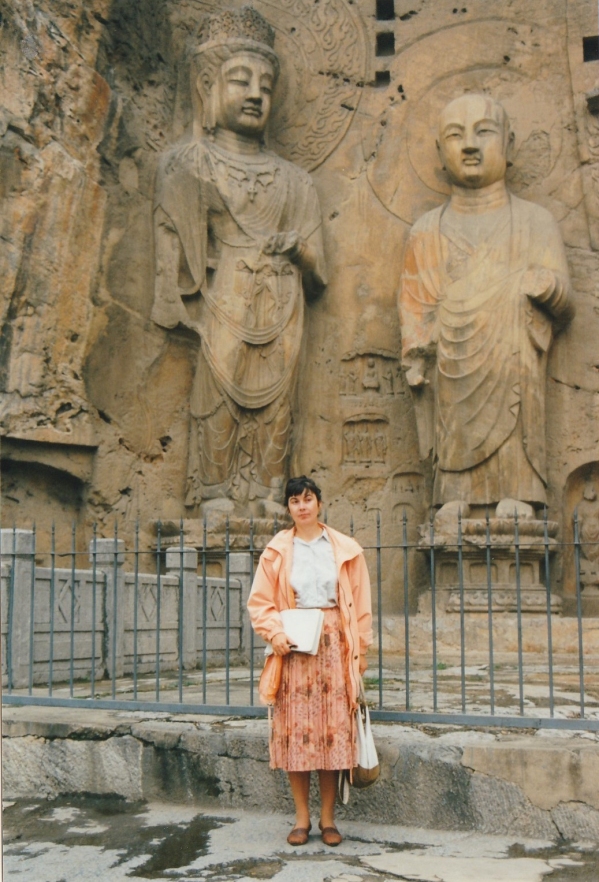
Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.
Wir fahren zu den Longmen-Grotten, 13 km von Luoyang, die in der steilabfallenden Schlucht des Yi-Flusses, dem Drachentor (Long Men) zu sehen sind mit zahlreichen Buddha-Statuen in Nischen und Schreinen in Fels gemeißelt. Es ist eine der bedeutendsten buddhistischen Kultstätten Chinas aus dem 7. Jahrhundert. Früher waren die Felsenskulpturen bunt bemalt. Sie erinnern an Datong, aber haben griechischen Einfluss. Die langen Ohren des Buddhas bedeuten Weisheit. Die Kaiserin Wu wird als weiblicher Buddha dargestellt. Mir fällt das Buch "Die eiserne Kaiserin" von Eleanor Cooney und Daniel Altieri ein. 690 n. Chr. bestieg Wu, eine ehemalige Konkubine, den Kaiserthron. Es passieren rätselhafte Morde, die der berühmte Richter Di, ein standhafter Konfuzius-Anhänger, aufklärte.
Der Reiseführer erklärt, dass es zweimal eine Kaiserin gegeben habe. Jedes Mal wäre es für das Land verheerend gewesen. Als ob die Kaiser besser gewesen wären! Ich denke dabei an das Buch, das ich später las: "Gott der Barbaren" von Stephan Thome, wie der Anführer der Aufständischen gepfählt wird. Mitte 19. Jahrhundert gibt es eine christliche Rebellion. Der Kaiser schlägt zurück. Was bedeutete es damals, als Frau an die Macht zu kommen? Oder ist es die männliche Geschichtsschreibung? Kaiserin Wu hatte die Göttin der Barmherzigkeit und nicht Buddha, da er ein Mann war, zu ihrem Vorbild erhoben.
Wie kommt es, dass einige Chinesen so reich sind? Wenn jemand ein schlechtes Geschäft macht, sagt man, vor seinem Laden könne man Vögel fangen. Geld kann man auch durch die "Hintertür" verdienen. Der Reiseleiter kennt eine Frau, die früher als Buchhalterin arbeitete. Sie lernte einen Mann in der Bauverwaltung kennen. 10 Tage ließ sie sich wegen einer Erkältung beurlauben und kaufte und verkaufte Baumaterial. Durch den Mann, den sie später heiratete, bekam sie die Genehmigung. Langsam wurde sie Millionärin. Eigentlich müsste sie viel Steuern zahlen, aber nur theoretisch.
Der Reiseleiter kennt einen ehemaligen Lehrer, der ihm von einem Bauern erzählte, der ein Kohlebergwerk besaß. Der Lehrer mietete es und wurde mit der Zeit Millionär. Zu Hause stehen bei ihm nun zwei japanische Autos. Ein Direktor einer Firma gibt Unsummen für teure Zigaretten aus. Wie viel ein Chefarzt verdient, wisse niemand. Es gibt zwar ein Grundgehalt, dazu kommen aber Prämien. Ärzte werden bestochen, damit sie Operationen früher durchführen. Normalerweise müssen Patienten darauf 2-3 Monate warten. Ein chinesisches Sprichwort sagt, wenn ein Karpfen über ein Tor springt, wird er zum Drachen. Geht ein Bauer in die Stadt, hat er das Tor übersprungen.
Wir sehen den Winterweizen auf den Feldern. Man muss keine Steuern zahlen, denn wenn das Hochwasser kommt, was nicht jedes Jahr geschieht, wird die Saat weggespült. Deshalb nennt man den Weizen, den man dort erntet, "Glücksweizen". Die Luft ist endlich wieder mild.
Beim Tempel "Zum weißen Pferd", der erste buddhistische Tempel in China, 68 nach Chr.: Der Kaiser träumte von einem goldenen, fliegenden Menschen. Das sollte Buddha sein. Die Sutren wurden von einem Schimmel getragen. Hier wohnte der geistig behinderte Mönch, den man als "Lachsack" überall kaufen kann. Ein Mönch schläft im Stehen.
Eine der Wächterskulpturen hat am Bauch Augen und eine Nase. Ein anderer Wächter trägt den Himalaya auf einer Hand. Elektrische rote Lampen erleuchten Buddha. Wenn man Mönch werden will, muss man die Genehmigung von seiner Familie, der Gemeinde, Polizei und des Klosters haben, wo man eintreten möchte. Mönche erhalten ein Taschengeld von der Regierung. Der Abt dieses Klosters hier ist Millionär, denn die Japaner haben viel gespendet. Früher mussten die Mönche auf dem Land arbeiten.
Ein Wächter steht da mit Metallohrringen. Dies ist eine Lackarbeit. Münzen soll man aufs Wasser legen. Gehen sie nicht unter, habe man ein langes Leben. Na, da müssten wir alle ein kurzes haben. Wie wird man reich? Polizisten betreiben Autowaschanlagen. Alle LKWs, die in die Stadt wollen, müssen erst einmal in ihre Waschanlage.
Wir sehen 'Frauen mit weißen Mützen'. Sie sind in Trauer und waschen Wäsche an einer Pumpe.
In einem Museum sehen wir ein Schattentheaterstück. Eine Frau fliegt vom Mond auf die Erde. Sie flirtet mit einem Mönch und möchte ein ganz normales Leben auf der Erde mit ihm führen. Sie tanzen zusammen. Der Mönch ist nicht abgeneigt und nimmt ihr Angebot an.
Im Museum sind große Puppen im Braut-Begleitzug ausgestellt. Die Braut wird von einer Frau geführt, die viele Kinder beiderlei Geschlechts hat. Wir gehen über eine hohe Schwelle und sind so sicher vor bösen Geistern. Wolkenkragen an Gewändern. Das Essen ist diesmal abenteuerlich. Seepferdchen als Vorspeise und Lilienblüten. Ente mit Schwimmflossen folgt. Wie erkannten früher Räuber, bei wem sie Lösegeld erpressen konnten? Sie setzten den Gefangenen Entenfleisch vor. Wer die Schwimmflossen aß, bei dem war nichts zu holen. Mir fällt das Buch ein: "Die Räuber vom Liang-Schan-Moor".
Toilettenpapier liegt als Serviette auf dem Tisch. Früher durften Hunde nicht gezüchtet werden. Ihr Fleisch ist teuer. Heute wurde das Verbot aufgehoben. Hunde sind aus hygienischen Gründen in der Stadt nicht erlaubt. Chinesen haben Angst vor Schäferhunden, denn sie verletzten Menschen.
Der Reiseleiter will noch etwas zu den Studentenunruhen 1989 in Peking loswerden. Er meint, die meisten Menschen in China sind Bauern, viele in der Bevölkerung können nicht lesen und schreiben. Die Studenten wären "Kinder" gewesen. Sie hätten keine Erfahrung gehabt, wussten nicht, was Demokratie bedeutet und ein "besseres" Leben. Der Reiseleiter wäre auch nicht mit allem zufrieden, aber dass die Regierung so scharf gegen die Studenten damals losging, musste sein. Der Staat wäre in Gefahr gewesen. Mein Mann widerspricht ihm heftig. Der Reiseleiter fragt ihn, ob er "Grüner" sei.
Abends Abfahrt im Nachtzug nach Nanking: Wir fahren am Vormittag zur berühmten Brücke über den Jangtse und gehen ein Stück darüber. Ich mache ein Foto von meinem Mann. An den Straßenrändern Schneezedern und französische Platanen, die so heißen, weil Franzosen sie anpflanzten. Man kann hier Süßwasserperlen kaufen, das Sinnbild der Jugend.
Eine Frau aus der Reisegruppe wollte unbedingt zu einem besonderen Haus und fragte den Reiseleiter, wie sie dorthin käme. Als sie nach geraumer Zeit wieder zurückkam, erfuhren wir, dass sie das ehemalige Haus von John Rabe besuchte. Sie erzählte dem Reiseleiter, dass sie noch einen ehemaligen Angestellten ihres Vaters, denn die Frau war die Tochter, getroffen hätte und dieser habe ganz dankbar von ihrem Vater gesprochen. John Rabe arbeitete von 1911-1938 bei Siemens China Co, war ab 1931 Geschäftsführer der Siemens Niederlassung in Nanking, der damaligen Hauptstadt Chinas. Rabe setzte sich während des Massakers von Nanking während der japanischen Besetzung 1937/1938 für die Errichtung einer großen Schutzzone ein und rettete mehr als 200.000 Chinesen. Auf seinem Grundstück ließ er eine große Hakenkreuz-Fahne aufspannen, unter der 600 Chinesen Schutz vor japanischen Bombern fanden. Buddhistische Klöster schützten auch Chinesen vor den Japanern. Die Besatzer haben das respektiert.
Am "Sun-Yat-sen-Mausoleum", das sich an den südlichen Ausläufern der Purpurberge befindet, gibt es Nanking-Kirschen, die nach Zimt duften. Hier kann man "Regenblumensteine" kaufen. Ein Mönch erklärte den Leuten den Buddhismus. Da regnete es Blumen vom Himmel auf die Steine, die dadurch bunt wurden. Die Farben sind besonders gut zu sehen, wenn die Steine im Wasser liegen. Hier gibt es auch "Tigersteine", das sind Ziegel, in die der Name des Herstellers und sein Wohnsitz eingeritzt sind. So konnte der Kaiser ganz schnell feststellen, wer schlechte Qualität lieferte. Dieser wurde dann getötet.
Wir kommen zum "Schwarzen Drachenteich", wo man einmal einen schwarzen Drachen gesehen haben will. Aus den "Purpurbergen" wurde Gold gewonnen.
Lotos-Wurzeln werden beim Essen serviert. Dies sind weiße Scheiben mit Löchern, die ein bisschen nach Rettich aussehen. Wir sagen "gab ai!" Das heißt "trockenes Glas", Prost!
Auf einem Fahrrad werden Lauchstangen auf einem Kindersitz transportiert. Wir sehen Behinderte, die vom Land kommen und für die es fast keine Unterstützung gibt. Nonnen kreuzen ihren Weg. Küken werden in einem Korb auf dem Fahrrad transportiert.
© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Foto von © Reinhild Paarmann, September 1994.
Zum Anfang
2025/06/10
Reinhild Paarmann
Reisebericht China 1994, Teil 3

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.
Wir erreichen Xian am späten Abend: Über der Toilette im Hotel hängt ein glasgerahmtes, großes Bild. Hier sehen wir viel mehr Radfahrer als in Peking. Ein alter Mann hält mit einer langen Stange, an der eine rote Fahne hängt, einen Radfahrer an. Er ist Hilfspolizist und Rentner, der sich seine geringen Bezüge aufbessert. Auf alte Menschen wird von der Regierung aus Druck gemacht, dass sie sich noch nützlich machen. Wer nicht auf seine Enkel aufpasst, soll sich nicht langweilen. Früher rekrutierte man aus Verkehrssündern Hilfspolizisten, die solange auf der Straße Dienst leisten mussten, bis sie ihren Job einem neuen geschnappten Verkehrssünder übergeben konnten. Aber die Leute passten dann so auf, dass es mit der Ablösung nicht mehr klappte. Deshalb änderte man das System.
Wir fahren an dem Grabhügel des ersten Kaisers von China Qin Shihuangdi vorbei. Er soll bei Xian in einem Boot auf dem unterirdischen Quecksilbersee schweben. Es wohne dort ein Drache, der, wenn er sich bewege, ein Erdbeben auslöse. Deshalb baute man auf seinem Kopf einen Glockenturm. Seitdem hätte es dort keine größeren Erdbeben mehr gegeben Die Sicherungsanlagen gegen Grabräuber sollen sehr raffiniert sein. Probebohrungen ergaben, dass die Erde tatsächlich einen hohen Quecksilbergehalt aufweist. Bisher hat sich keiner getraut, das Grab zu öffnen.
Bis zur Terrakottaarmee des Qin Shihuangdi ist es noch ein Stück zu fahren. Sie befindet sich unter einer gewaltigen Halle. Ein "Schutzblech" aus Pappe sehen wir an einem Fahrrad.
Terrakotta-Armee: Bis zu 6.000 Krieger und Pferde birgt die Grabkammer um 200 vor Chr. geschaffen. Armbrüste aus Holz sind bei den Kriegern verrottet. Eine japanische Firma vergibt Lizenzen zum Fotografieren, aber diese sind schwindelerregend hoch. Die beschädigten Figuren sehen aus, als lägen sie auf einem Schlachtfeld. Die Skulpturen waren bemalt, jetzt ist die Farbe verschwunden. Sie sehen wie Roboter aus und erinnern mich an die Panzerriesen in Michael Endes "Unendliche Geschichte". Wer von den Figuren ist der ewige Kämpfer? Ich suche den Diener, der eine Frau des Kaisers liebte, was verboten war und der zur Strafe abgebröckelten Ton aufgeklebt bekam. Diese Frau sollte für den Kaiser nach Westen ziehen, um das Mittel gegen die Sterblichkeit zu holen. Warum hatten die Kaiser so Angst vor dem Tod? Waren sie nicht mal unsterblich gewesen?
Die Pferde in der Terrakotta-Armee: Ein gutes Schlachtross hat bogenförmige Hinterbeine, leicht geöffnete Nüstern zum Zeichen, dass es eine gute Lunge hat und Ohren wie Bambusspitzen. Die Händler am Rande der Anlage verkaufen Hunde- und Fuchsfelle.
Wir fahren zur "Kleinen Wildganspagode", die ein scheues Mädchen sei, wogegen die große einen robusten Mann darstelle. Bei der "Kleinen Wildganspagode" habe es einen Riss durch ein Erdbeben gegeben, eine weitere Erschütterung habe ihn geschlossen. Das Dach der Pagode ist grün, die Farbe des Kaisers. Mönche sollten enthauptet werden, wenn sie sich anmaßten, ihre Gebäude mit grünen Ziegeln zu versehen. Sie argumentierten, dass sie sich diese aus dem alten Kaiserpalast geholt hätten, da der Kaiser ihnen keine spendete. Da verzieh ihnen der Kaiser.
In einem Andenkenladen steht ein beheizbares Bett, wie die Chinesen es früher hatten. Der Ofen daneben führt seine Rohre mit warmer Luft unter das Bett.
Ich entdecke Schattenfiguren aus Ochsenleder, obwohl der Reiseführer mir sagte, es gebe hier keine mehr. Ich hatte den Film "Leben" gesehen und glaubte selbst kaum, dass es in China noch Schattenfiguren geben könnte, denn die Kulturrevolution hatte sie fast alle verbrannt.
Manche Leute führen im Freien Tai Qi aus. Die Bewegungen sind rundlich, als ob sie über eine Kugel geführt werden würden. Energie wird angesammelt, um gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen zu können.
Ob die Küchengöttin Tai Qi gegen ihren Mann, den Feuergott, einsetzte? Ich sehe einen alten Kochherd. Mir fällt sofort die Geschichte von Amy Tan ein: "Die Frau des Feuergottes". Hier werden dem Feuergott Karamellen geopfert, damit er nicht schimpfen kann.
In der "Großen Wildganspagode", dem Kloster des großen Wohlwollens aus der Tang-Zeit, sehen wir Kissen, die aus Bonbonpapier gefaltet sind. Darauf knien Leute, damit ihnen ihre Sünden vergeben werden. Ein hölzerner Fisch wird als Trommel geschlagen. Räucherstäbchen werden entzündet, damit Buddha riecht, dass ein Gläubiger betet und seine Wünsche äußert.
Skulpturen mit langen Augenbrauen stehen hier, die ein langes Leben symbolisieren.
Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem schweineköpfigen Gott? Er liebte eine Irdische und wurde auf die Erde in einen Schweinestall geworfen, sein Kopf nahm die Gestalt eines Schweines an.
Woher kommt der Name "Wildganspagode?" Einmal hatten die Mönche Hunger. Sie beteten zu Buddha. Buddha flog als dicke Wildgans mit einer Schar vorbei und opferte sich im Sturzflug. Die Mönche erkannten ihn aber und begruben die Wildgans. Wie sie nun ihren Hunger stillten, ist nicht bekannt. Der Teppich wird mit einem Strohbesen gekehrt. Kriegsverletzte betteln. Auch Kinder. Ein Mut-Test: Tigerbalsam in die Augen schmieren.
Wir essen wieder leckere Teigtaschen, für die es verschiedene Füllungen und Formen gibt. Eine Teigtasche in Ohrenform wird im Winter gegessen; sie soll gegen kalte Ohren helfen.
Wir fahren zum Palast der heißen Quellen zur Halle des schwebenden Raureifs. Thermalquellen "Huaqing Chi". Auf dem Berg steht ein Feuerturm, von dem man bei Alarm Zeichen in das Land schickte. Es lebte dort eine Konkubine, die nie lächelte. Damit seine Geliebte endlich fröhlich würde, ließ der Kaiser Alarm durch das Anzünden des Feuers auf einem Turm auslösen. Alle Soldaten aus dem ganzen Land kamen – und die Konkubine lächelte über das Durcheinander und das nutzlose Dahineilen. Als das nächste Mal Feuer im Turm leuchtete und es wirklich brannte, kam keiner mehr. Der Palast wurde dem Erdboden gleichgemacht. Heute ist er wieder aufgebaut worden.
Hier fand der Zwischenfall von Xian statt. Chiang Kai-shek flüchtete im Schlafanzug aus einem Haus in die Berge, als 1936 seine Generäle ihn festnahmen, damit er gegen die Japaner kämpfe.
Am Abend regnet es. Wahrscheinlich hat ein Drache mit einer Perle gespielt. Unser Taxifahrer will eine horrende Summe, als wir zum Hotel fahren. Vorsichtshalber hat er das Taximeter vorher mit einem Stück Teppich verhängt, nun lüftet er ihn. Es erscheint eine Fantasiesumme, die nichts mit der Höhe der Forderung zu tun hat. Seine Freundin sitzt neben ihm. Wir bezahlen etwas mehr, als wir erwartet haben, aber nicht den geforderten Betrag. Später erfahren wir, dass je nach Autotyp bezahlt wird. Es war wohl ein besseres Auto.
Ein Fahrrad transportiert unverpacktes Fleisch. Jade soll kristallines Mondlicht sein, der Lebenshauch, wie wir von unserem Reiseleiter erfahren. Jade symbolisiere Menschlichkeit und Aufrichtigkeit. Eine Zikade aus Jade ermögliche die Wiedergeburt.
In der Eisenbahn nach Luoyang, eine der sechs historischen Kaiserstädte, sehe ich aus dem Fenster. Kinder spielen auf einem Dach. In einem Baum hängt Mais zum Trocknen. Kinder ziehen einen Pflug.
Eine Frau fährt Fahrrad, ein Mann sitzt hinten auf dem Gepäckständer. Ein Vater fährt sein Kind auf dem Fahrrad. Auf dem Gepäcksitz hockt das Kind und hält sich an einer Querstange fest. Ein Busfahrer hat Mao am Spiegel hängen. Ansonsten habe Mao keine Konjunktur mehr. Ich sehe ihn auf einem Feuerzeug, das man ausklappt, worauf eine Spieldose mit Musik losrattert. Auf einem Ramschtisch die "Mao-Bibel".
Ich erinnere mich an die Zeit der Kulturrevolution, in der mein Mann und ich noch nicht wussten, dass Horden von Jugendlichen alles Kulturelle in China zerstörten, Menschen töteten. Wir hatten wie viele Linke Sympathie für das kommunistische China. Mein Mann trug ein rotes, samtartiges China-Hemd mit aufgesticktem gelb-grünen Drachen. Er kaufte das rote Büchlein von Mao für 2,- DM. Wir lasen in dem Buch: "Die proletarische Literatur und Kunst ist Teil der gesamten revolutionären Sache des Proletariats." Ja, das gefiel uns damals. Die Kunst sollte nicht der oberen Klasse gehören. Kunst von unten. Mao als Dichter gefiel mir. Manche, die sich in den Zeiten des "Kalten Krieges" langweilten, kokettierten damit, Revolutionäre zu werden. Ein Reiseführer berichtet, wie er Mao und seine Politik "genossen" habe. Seine Eltern waren Gemüsebauern. Sie erhielten vom Staat ein Stück Land. 1956 wurden dann Produktionsgruppen eingerichtet. Kommunen entstanden. Alle Menschen an einem Ort saßen zusammen in einer Kantine.
Er wurde 1953 geboren und ging später in einen Kindergarten. Erst lebt seine Familie im Wohlstand. In dieser Zeit wurde die Idee der Kommune fast verwirklicht. Dies ging sieben Monate gut, dann verschlechterte sich der Lebensstandard. Täglich konnten sie nur noch zwei Schalen mit Gemüseblättern essen. 15 kg Getreide bekam man im Monat pro Kopf als Bauer. Aber man durfte nicht zu Hause kochen. Der spätere Schwiegervater war zu dieser Zeit Lastwagenfahrer. Er hatte sechs Kinder zu ernähren. Da das Essen nicht reichte, kaufte er heimlich einen Sack Weizen. Ein Kollege verriet ihn. Der Weizen wurde ihm weggenommen. Die Schwiegermutter sei seit dieser Zeit geistig behindert. Sie schweige.
Was der Bauer produzierte, musste er abliefern. Es gab keinen Dünger mehr, weder Fleisch noch Tofu. 50 g Öl erhielten sie nur im Monat. Vier Personen mussten bei ihm zu Hause ernährt werden. Später durfte man wieder zu Hause kochen. Als Kind sammelte er Rübenblätter, sie wurden mit Salz vermischt gegessen. Einmal besuchte sie ein Kind aus der Verwandtschaft und bat um Essen, da die Mutter krank wäre. Sie wiesen es ab, weil sie selbst kaum etwas zu essen hatten. Dabei ging es ihnen im Ort noch relativ gut. Die Bauern auf dem Land hatten es viel schlechter. 90 % ihrer Produkte mussten sie der Regierung abliefern. Eine katastrophale Dürre kam. Die Regierungsbeamten sagten: "Ihr müsst Geduld haben! Der Kredit an die Sowjetunion muss eher zurückgezahlt werden." Dadurch verschlechterte sich die Lage noch mehr. Viele Bauern verhungerten.
Sie aßen weiße Erde, aus der Porzellan hergestellt wird und starben. Wildkräuter und Baumrinde von den Weiden, Ulmen sowie Akazienblätter wurden in der Not gegessen. Die Rinde trocknete man und mahlte sie zu Mehl. 4-5 Tage hatten sie nicht zu essen. Ein Bauer, der so lange hungerte und dann eine Schüssel mit Essen vorgesetzt bekam, starb danach. Er hatte sich an der harten und zu heißen Rinde verletzt.
Drei Jahre, zwischen 1959 und 1961, herrschte die Hungersnot. Der Vater des Reiseleiters bekam Wassersucht und wurde dick.
1962 verbesserte sich die Lage. Getreide und Öl bekam man vom Staat. Dennoch war die Familie sehr arm. Dann durfte sie ein Stück Land von 80 qm privat nutzen. Der Vater baute Lauch an. Die Ernte musste er verkaufen. Der Preis wurde stattlich kontrolliert. Als Kinder hätten sie heimlich Lauch verkauft. Sie klopften an Türen. Wenn jemand von der Polizei kam, die Bewacher war und eine rote Armbinde trug, rannten sie schnell weg. Freien Markt wie jetzt gab es damals nicht. Ab 1965 wurde eine neue Politik verkündet, seitdem ist das Leben der Bauern besser. Ein Jahr war Freimarkt erlaubt. Dann kam im Herbst die Kulturrevolution. Da war der Reiseleiter 13 Jahre alt und besuchte die Mittelschule. 1966 hatte er nur zwei Monate Unterricht, denn er wurde verpflichtet mit der Losung: "Wir müssen gegen die alten Gedanken, Gebräuche und Sitten kämpfen!", Aktionen gegen die Gutsbesitzer und alle Tempel durchzuführen. Wie alle anderen Schüler zerschlug er Porzellan, Bilder und verbrannte Bücher. In den Klöstern zerstörten sie Buddha-Figuren. Die Schüler mussten zur Roten Garde. Wer nicht teilnahm, wurde kritisiert. Es gab eine Kampfgruppe, um Mao zu schützen. Direktoren und Kapitalisten wurden kritisiert. In den Firmen arbeitete man nicht, sondern kritisierte. Auf Wandzeitungen erschienen die Kritiken. Alle nahmen an der Bewegung teil.
Die Leute stritten darüber, ob ein Direktor gut oder schlecht war. In dem Ort des Reiseleiters behauptete eine Gruppe, nur aus Revolutionären zu bestehen, alle anderen Leute wären keine. Da gab es Kämpfe. Erst sprachen die Fäuste, dann Ziegelsteine, Knüppel, es folgten Waffen aus Eisen wie Messer und Lanzen.
Früher hatte sein Ort noch eine Stadtmauer aus der Ming-Zeit. Aber durch den Krieg wurde sie stark beschädigt. Den Stadtkern trafen Bomben. Sie bauten an den Kreuzungen der Hauptstraßen Bunker, hoben Schützengräben aus. 60 % der Gebäude brannten ab. 80 % der Bauten waren nach dem Krieg zerstört. Vom Frühling 1967 bis zum Herbst 1968 flüchteten viele aufs Land. Die Innenstädte wurden umzingelt. Es gab keine Nahrungsmittel mehr. Über Funk riefen sie um Hilfe. Zhou Enlai hörte in Peking den Hilferuf. Er schickte Truppen, aber das half nichts. Nach einem Monat kam eine weitere Truppe mit Panzern und Hubschraubern. Die Verantwortlichen wurden Ende 1968 ins Gefängnis gesteckt. Im Frühjahr 1969 ging es langsam aufwärts. Die Kinder besuchten wieder die Schule, die Arbeiter gingen ihrer Beschäftigung nach. In der Heimatstadt des Reiseleiters war das Krankenhaus beschädigt worden und der Betrieb für Tiefbauarbeiten. 30.000 Einwohner hatte die Stadt vor dem Krieg. 1/6 war durch den Krieg umgekommen. Nur in zwei bis drei Städten war es schlimmer als bei ihnen. Das kam daher, weil die Stadt in einem strategisch wichtigen Gebiet lag, inmitten der Grenzen von drei Provinzen.
1969 war die Kulturrevolution zu Ende. Alle, die 16-17 Jahre alt waren, mussten am Krieg teilnehmen. Wer das nicht wollte, wurde geschlagen. Der Reiseleiter hörte nachts die Schreie der Geschlagenen. 1972 konnte er die Mittelschule beenden.
Er musste Bauer werden. Später bildete er Jugendliche zu Bauern aus. Er durfte bei seinen Eltern leben und arbeiten. 1975 wurde er von den Bauern ausgewählt, damit er Deutsch studieren durfte, was er ab 1978 tat. Anschließend arbeitete er als Übersetzer für die Partei und das Telefonwesen. 1979 heiratete der Reiseleiter. Seine Frau arbeitet auch. Sie haben zusammen eine Tochter. Da seine Frau an einem anderen Ort als er arbeitete, beantragte er eine Versetzung. Sechs Jahre musste er warten. Dann wurde sein Wunsch erfüllt.
Viele junge Studenten, die auf das Land mussten, heirateten eine Bäuerin. Wenn sie dann in die Stadt zurück wollten, mussten sie sich scheiden lassen. 1976 starb Mao. Die Kommunen wurden aufgelöst. Jede Familie erhielt vom Staat ein Stück Land. 4-5 % der Einnahmen müssen sie an den Staat abgeben. Wer arbeitslos ist, erhält 40-50 % seines vorherigen Verdienstes. Viele eröffnen eine Garküche, weil sie da keine Steuern zahlen müssen.
Die Tochter des Reiseführers ist unterdessen 14 Jahre alt. Sein Sohn wird sieben Jahre. Da seine Frau zu einer ethnischen Minderheit gehört, durfte das Paar zwei Kinder bekommen. Als sein zweites Kind unterwegs war, betete seine Mutter zu Buddha, damit es ein Junge werde. In einem Kloster erhielt sie ein Mittel, das seine Frau dreimal täglich nehmen sollte, damit es ein Junge werde. Alle in seinem Bekanntenkreis wollten den Namen der Medizin wissen, er durfte ihn aber nicht verraten.
1977 wurde über Familienplanung informiert. Erst ab 1980 führte man die Ein-Kind-Politik streng durch. Schwierig wird es nach einer Scheidung. Eine Tochter war nach der Trennung beim Vater geblieben. Die Frau, die er nun neu heiratete, wollte ein Kind von ihrem Mann. Sie musste sich sterilisieren lassen. Eine andere Frau war im 6. Monat schwanger. Da sie aber schon zwei Kinder hatte, wurde zwangsabgetrieben. Diese Frau hatte zwei Töchter. Bei der Abtreibung sah man, dass es ein Junge geworden wäre. Das ganze Dorf trauerte mit ihr, denn hier ist es besonders schlimm, wenige Kinder zu haben. Jungen sind auf dem Land mehr wert, sagte der Reiseführer. Kinder fehlen dort als Arbeitskräfte. Ihr Mann wurde verrückt und tötete alle Familienmitglieder. Dann zündete er die Wohnung an.
Eine Bäuerin musste sich nach dem zweiten Kind sterilisieren lassen und ein Strafgeld zahlen. Da sie das Geld nicht hatte, wurde ihre Wohnung mit einem Traktor zerstört. Deshalb existieren viele "Schwarzkinder", das sind Kinder, deren Eltern mit den überzähligen Kindern in die Stadt ziehen. Nach ein paar Jahren kehren sie auf das Land zurück. Manche Eltern reisen von Stadt zu Stadt und verstecken ihre Kinder bei Verwandten. Nur den ethnischen Minderheiten sind so viele Kinder erlaubt, wie sie möchten. Da geht es aber danach, wie viele Kinder der Mann will. Das finden die Frauen ungerecht. Der Reiseleiter sprach einmal mit so einer Frau, die 21 Jahre alt war und schon vier Kinder hatte. Sie wollte keine mehr. Mit 16 Jahren hatte sie geheiratet. Aber wenn ihr Mann es will, muss sie noch mehr gebären.
© Reinhild Paarmann, Juni 2025.
Zum Anfang
2025/06/06
Reinhild Paarmann
Reisebericht China 1994, Teil 2

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.
Am nächsten Tag fahren wir mit unserem Bus ca. 60 km nördlich von Peking zur Großen Mauer. Wir stehen im Stau. Per Lautsprecher wird mitgeteilt, dass Kinder nicht an die Mauer pinkeln dürfen. Chinesische Kleinkinder kennen keine Windeln. Wenn sie sich bücken, blitzt der Popo auf, denn die Hose ist hinten offen. Überall sieht man, wie Kinder sich hinhocken, um ihr großes Geschäft zu machen. Einmal beobachte ich, wie eine Mutter ein Papiertaschentuch auf das Pflaster legt, das Kind kotet darauf. Ein anderes Kind pullert in eine Bronzelampe, worauf die Mutter es erschrocken hochhebt und auf dem Gehweg weiter urinieren lässt.
Viele Chinesen sind als Touristen unterwegs. Es ist etwas windig, die Sonne scheint, blauer Himmel mit weißen Wolkenschleiern.
Mir fällt die Geschichte von Meh-ling ein, einer jungen Frau, die zu Kwan-yin betet, der Göttin der Barmherzigkeit, damit die Mauer an der Stelle zusammenbricht, unter der ihr Mann begraben ist. Im Roman "Die Tränenfrau" von Su Tong, der auf dieser Geschichte basiert, bringt die junge Frau mit ihren Tränen die Mauer zum Einsturz und befreit sich dadurch selbst von ihrem Kummer, wie ich später las.
Nicht weit entfernt von der Großen Mauer befinden sich in einer nach Norden hin abgeschlossenen Talsohle die Ming-Gräber. 13 von 16 Ming-Kaisern sind hier beigesetzt. Wir betreten das Gräber-Tal durch ein Ehrentor, die Pforte zum "Weg der Seelen". Da gibt es eine Toilette, vor der ein kostbarer Wandschirm steht.
Im Stelen-Pavillon (aus dem Jahr 1426) ist eine große Stein-Schildkröte zu sehen. Fasst man den Kopf an, soll man alle Sorgen loswerden; berührt man den Schwanz, wird man gesund. Dann beginnt die Allee der steinernen Statuen. Sie führt zu dem großen Grabhügel Changling von Kaiser Yongle. Vor dem Grab, zu dem wir wollten, steht eine riesige Menschenschlange. Da müssten wir zwei Stunden warten. Wir gehen lieber in ein Restaurant, in dem wir "Lange Nudeln" essen, denn das garantiere ein langes Leben. Ich weiß zwar nicht, ob ich ein langes Leben haben will, aber die Chinesen möchten das.
Am Abend fahren wir zum Bahnhof, wo Massen von Leuten auf Zeitungen sitzen oder auf ihnen schlafen, Karten spielen, alle scheinen zu warten. Wir fahren mit dem Nachtzug nach Datong, was "große Harmonie" heißt und kommen am frühen Morgen an. In dem Eisenbahnwagen gibt es ein Klo mit einem Loch im Boden. Es ist noch kälter als in Peking. Einige Leute im Park machen Tai-Qi. Die Bewegungen sind langsam, sodass sie sicher nicht davon warm werden. Die Tischdecke im Hotel besteht aus einem Bettlaken, sie hat Löcher und ist schmutzig. An der "Neun-Drachen-Mauer", der ältesten und größten Chinas, stehen Häuser, auf deren Dächern Frühlingszwiebeln trocknen. Im "Unteren Huan Kloster Xia Huan Si" berichtet der Reiseführer von einer buddhistischen Sekte, konnte aber nicht erklären, inwieweit sie sich vom sonstigen Buddhismus unterscheidet. Durch viele Jahre Kommunismus sind die Chinesen ihrer eigenen Kultur und Religion entfremdet, obwohl das Interesse daran langsam wieder zunimmt. Der chinesische Reiseführer kauft sich ein buddhistisches Amulett, obwohl es doch Aberglaube sein soll, wie er vorher erklärte.
Wir fahren zu den buddhistischen Yungang-Grotten. Sie ziehen sich an einem steilen Sand-Hang über einen Kilometer hin mit vielen Darstellungen Buddhas. Buddha-Figuren werden hier gerade geweiht, indem ein Priester Papiere mit Sutren in eine hohle Figur steckt. Auf einem Dach sehen wir Drachenreiter. Da sitzt der Sohn des Drachens, der das Feuer löschen soll. Hier fehlen die großen Messingschalen, die vor dem Kaiserpalast zu diesem Zweck stehen. In Datong wäre das wohl zu teuer, denn es ist ein ärmlicher Ort mit wenig Touristen. Überall hängt Kohlegeruch in der Luft. Leute fegen den Kohlestaub auf der Straße zusammen, um damit zu heizen. Ein Wasserträger mit seiner Stange über den Schultern, an jedem Ende hängt ein Eimer, geht vorbei. Ein Mann zieht an einem Strick mit einer Hand ein Fahrrad, mit der anderen Hand den Wagen.
Wir gehen abends allein los und besuchen ein Lokal. Auf der Speisekarte steht in Chinesisch und Englisch, was man bestellen kann. Ich suche mir Spinat mit Schweinefleisch aus, erhalte aber Tintenfisch mit Saugnapfarmen. Da ich ein bisschen Chinesisch kann, versuche ich, mich mit Chinesen zu unterhalten, die teilweise ein wenig Englisch können und erfreut reagieren. Die Chinesen wollen wissen, wie ich heiße und bieten mir Zigaretten an. Ich habe nur bis Lektion drei meines Chinesisch-Buches gelernt, also können wir nicht viel miteinander reden.
Auf dem Rückweg zum Hotel sehen wir einen Mann mit einem Affen, der für Geld Purzelbäume schlägt.
Am nächsten Morgen baumeln Schweinehälften vor Garküchen auf der Straße. Ein Schulkind mit einer Tasse in der Hand läuft vorbei.
Wir kommen auf den Bahnhof, wo ein Mann mit einem riesigen Besen, der auf Rollen geschoben wird, sauber macht. Wir steigen in den Zug nach Taiyuan ein. In der Eisenbahn laufen Leute mit Marmeladengläsern, in denen Urin farbige Flüssigkeit ist. Ich frage und erfahre, dass es sich hierbei um Tee handele. In der Eisenbahn gibt es heißes, abgekochtes Wasser, mit dem man sich einen Tee brühen kann. In den meisten Hotels steht abgekochtes, heißes Wasser in einer Thermoskanne, dazu gibt es Teebeutel und Tassen. Es ist sehr angenehm, wenn man in das Hotelzimmer kommt und sich gleich einen Tee machen kann.
Am Bahndamm hocken Leute und kochen. Im Speisewagen wird Hühnerfleisch mit Hühnerkrallen angeboten. Die Kartoffeln sind köstlich kandiert. Poppige Parteimusik tönt aus den Lautsprechern. Während der Nachtfahrt finden wir das gar nicht lustig, als um 1 Uhr ein Kabarett mit Salvengelächter durch das Mikrophon schallt. Der Lautsprecher ist nicht abzuschalten. Der Reiseleiter beendet das Martyrium, indem er die Leitung herausreißt. Endlich tritt Ruhe ein.
Wir fahren durch eine Landschaft, die aus Feuer und Rauch durch den Kohlenabbau besteht bis Taiyuan. Dort essen wir gefüllte Teigtaschen. Einer aus unserer Gruppe schafft 31 davon!
"Was bedeutet "Revolution"?", fragt uns der Reiseleiter. Nach einer kurzen Pause sagt er: "Den Auftrag des Himmels entziehen.", das bedeutet das Mandat des Himmels zur Herrschaftslegitimation des Kaisers entziehen. Durch das Tai Qi erlangen die, die es ausführen, Unsterblichkeit.
Eine Entenherde auf der Straße wird von ihrem Hirten gescheucht. Dattelbäume. Aus den Früchten wird Schnaps gebrannt. Auf den Feldern wächst Sorghum, eine maisähnliche Pflanze, die ursprünglich aus Afrika stammt. Daraus kann man auch Schnaps herstellen, der im Winter getrunken wird. Bambus- und Rosenschnaps sind im Angebot. Ein Mädchen steht auf einem Motorroller, der Vater sitzt und fährt.
Die Anlage zum "Jin Tempel" aus dem 11. Jahrhundert: Hier gibt es den Jungbrunnenfluss, der entstand, weil eine Bauernfrau dort lebte, die mit ihrer Zauberkraft beliebig den Wasserkübel füllen konnte. Die neidische Schwiegermutter missbrauchte den Zauber, wodurch es eine Überschwemmung gab, aber sie war nicht dumm und setzte sich auf den Kübel. Mir fällt der "Zauberlehrling" von Goethe ein. Seitdem entströmt dem Kübel die "Quelle der Jugend", eine unerschöpfliche Erneuerung wie der Schoß einer Frau, na ja, solange sie im gebärfähigen Alter ist. Wir kommen zu einer Glücksbrücke bei alten Zypressen. Daneben stehen Akazienbäume, die viele Jahre auf ihren Buckeln haben. Kein Wunder, wenn sie aus dieser Quelle trinken! Im Boden wächst eine besondere Sorte von Reis, die sehr teuer ist. Das Wasser wird außerdem zur Verbesserung der Akustik bei den Wasser- und Spiegelterrassen verwendet. Unterirdisch sind Tanks eingelassen, damit man die Schauspieler besser hört, denn die auf den Nebenbühnen könnten sonst die Töne überschallen. Es entsteht ein Echo-Effekt. Theater wurde für die Ahnen aufgeführt.
Bilder erzählen von einer chinesischen Prinzessin, die nach Tibet geschickt wurde, um dort den König zu heiraten. Sie brachte Seidenstoffe und technische Errungenschaften mit.
Die Wächterskulpturen verloren bei der Kulturrevolution ihre Schwerter. Die Seitenteile einer Brücke bestehen aus Flügeln. Wir betreten die Halle der Heiligen Mutter für die Hüterin des Jungbrunnens. Früher waren die Fenster mit Reispapier beklebt und darauf schöne bunte Scherenschnitte angebracht, um sie zu verzieren. In der Halle werden Pfirsiche geopfert, die ein langes Leben bedeuten, Hefeklöße und Mondkuchen.
Die Hofdamen sind als Skulpturen angetreten, um ihrer Herrin zu dienen. Die Beamtinnen haben ein Ohr größer, das zur Herrin weist. Die erste Dienerin hält ein Lampion am Stock, die zweite ein Tuch, mit dem sie sauber macht, die dritte umfasst einen Besen, um den Hof zu fegen, die vierte walkt mit einer Stange die Wäsche. Eine Amme stammt aus der Mongolei, wie man an ihren Augen sieht. Die Köchin trägt ein Küchentuch auf einer Schulter, sie sieht unzufrieden aus, ist älter, muss Geld verdienen, ihre Kinder sind allein zu Hause, dann steht da die Begrüßungsdame, eine Pförtnerin, die größeren Frauen tanzen, vier schöne Künste werden ausgeführt: das Spielen von Musikinstrumenten, die Malerei, das Schachspiel und die Literatur, zu der die Kalligrafie gehört.
Die Bauern arbeiten im Winter auf Baustellen in der Stadt. Mais liegt auf den Dächern zum Trocknen.
Abends gehen wir "Feuertopf" essen. Man kocht sich in der Brühe im Topf, der über einer Flamme hängt, sein Fleisch und Gemüse selbst am Tisch. Lilienblätter gibt es dazu. Frösche im Bassin ahnen nicht, dass Restaurantbesucher sich welche zum Essen aussuchen.
Wieder in der Eisenbahn wird mit Feuer gekocht. Ab und zu sieht man ein paar Bäume auf den Bergen wie Härchen. Sonst nur Ziegeleien, Feuer und Rauch. Im Speisewagen ist die Plastikblume in der Vase auf dem Tisch in Folie eingepackt. Tee und Gabeln werden nicht angeboten.
© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.
Zum Anfang
2025/06/02
Reinhild Paarmann
Reisebericht China 1994, Teil 1

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.
Peking: Obwohl es September ist, empfängt uns ungewöhnliche Wärme bei der Landung. Wir kommen mit unserer Reisegruppe im "New World Hotel" unter, einem glitzernden Hotel-Turm. Es scheint erst vor kurzem eröffnet worden zu sein. Alles riecht noch nach neu.
China-Reise in 20 Tagen von Nord bis Süden, eine Reise in eine neue Welt für uns. Als wir aus dem Hotel kommen, fallen uns zuerst die Fahrradwege auf, die so breit wie die Straßen sind. Im "Tempel der Erde" essen wir. Ein Tourist hält in der rechten Hand ein Stäbchen, in der linken Hand die Gabel. Die Glasplatte auf dem Tisch kann man drehen; es stehen viele Schälchen und Platten mit verschiedenen Gerichten darauf, was wir auf der Reise noch oft erleben werden. Im Garten steht der Löwe, in dessen Maul ein Räucherstäbchen angezündet ist, als ob er rauche.
Jade-Gesundheitskissen verkauft ein Souvenirladen.
Ein Kind fährt seinen Großvater mit dem Fahrrad auf einem Anhänger. Bremsen sind selten an Fahrrädern. Wir sehen, wie jemand mit dem Fuß das Vorderrad zum Stehen bringt.
Unser Busfahrer sitzt mit Handschuhen am Steuer. Handtücher bedecken die Sitze im Bus.
Im Hotel gibt es im Schrank automatisch Licht, wenn man ihn öffnet. Radfahrer bewegen sich im Dunklen ohne Licht.
Abends in der Peking-Oper: Man bekommt kleine Näschereien und Tee. Die Tasse ist mit einem Deckel geschlossen, der Tee nicht gesiebt. Ein Tänzer trippelt wie ein Pfau seine Kreise. Mit doppelt so langen Armen tritt ein Schauspieler auf. Die bandagierte Hand eines Schwertkämpfers ist zu sehen. Sogar Mönche sitzen im Zuschauerraum.
Am nächsten Morgen sehe ich einen Mann in schwarzen Perlonstrümpfen, der die Fassade des Hotels putzt.
Wir lernen, mit dem kleinen Finger eine Eins zu zeigen, mit dem Ringfinger die Zwei, der Mittelfinger bedeutet die Drei, es kommt immer ein Finger mehr dazu bei einer höheren Zahl.
Mond und Sonne zusammen bilden das Zeichen für Helligkeit. Beim Qigong trägt man in einer Hand den Mond, in der anderen die Sonne mit ausgebreiteten Armen, rollt sie die Arme hoch und runter, führt sie mit den Händen zusammen.
Wir haben zwei Reiseleiter: einen deutschen und einen chinesischen. Der eine sagt, Schulpflicht bestehe für neun Jahre, der andere meint, es gebe keine Schulpflicht.
Betreut werden die jüngeren Kinder in einem Kindergarten oder in einer Vorschule, aber auch in Kinderheimen, in denen sie wochentags bleiben, am Wochenende holen sie die Eltern nach Hause. Die Kindergärten werden von den Firmen und Eltern finanziert. Berufsschulen entwickelte man nach deutschem Vorbild. Wenn man studieren möchte, muss man Abitur machen und eine Aufnahmeprüfung bei der Universität bestehen. Je nachdem, welche Punktzahl man erreicht, geht man auf eine bessere oder schlechtere Universität. Mauern schotten die Universitäten von der Außenwelt ab, damit sie sich als eine Einheit zu erkennen geben. Die Studenten wohnen in einem Studentenwohnheim. 4-6 Studenten teilen sich ein Zimmer, das eine Größe von bis zu 12qm hat. Früher war das Studium kostenlos; jetzt werden Gebühren erhoben. Es ist für Studenten schwierig, einen Job zu finden, wenn sie nicht reiche Eltern haben. Das Studium ist so zeitaufwändig, dass Studenten nur in den Ferien arbeiten können.
An den Straßenrändern oder auf dem Zwischenstreifen sieht man öfter Polizeipuppen. Ich wundere mich. Wahrscheinlich sollen sie die Verkehrsteilnehmer immer zum vorsichtigen Verhalten ermahnen.
Durch die Ein-Kind-Politik ist ein Kind hier der "Kaiser". Sie wünschen sich, zu MacDonalds an ihrem Geburtstag zu gehen, obwohl sie diese Kost gar nicht mögen. Obwohl Kinder das wissen, wünschen sie sich beim nächsten Geburtstag wieder MacDonalds. Die Eltern müssen umgerechnet ca. 600,- DM Strafe bezahlen, wenn sie ein weiteres Kind in die Welt setzen. Haben sie nicht das Geld, werden sie von einer Kommission gepfändet, das heißt, dass auch die Möbel mitgenommen werden.
Peking ist gerade wunderbar geschmückt wegen der Feierlichkeiten zum 1. Oktober, dem Gründungstag der Volksrepublik China, an dem 1949 Mao Zedong auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Volkrepublik China ausrief. Überall sieht man Blumentribünen. Später besuchen wir den Kaiserpalast, früher die "verbotene Stadt" genannt. Wir kommen durch das Mittagstor vom Tian’anmen-Platz. Die breite, weite mit verschlungenen Drachenreliefs verzierte Marmortreppe hinaufgehend, erreichen wir die drei "Großen Hallen des Volkes", Mao Zedong-Gedenkhalle, Museum der chinesischen Geschichte. Der Wind ist unangenehm. Wüstenwind. Auf der einen Seite die weiße reich verzierte Treppe, auf der anderen die Sicht auf gelbe Dächer.
Im Palast-Museum besuchen wir die Uhren-Ausstellung, eine Sammlung des Kaisers. Später im Studium lese ich das Buch: "Cox oder Der Lauf der Zeit" von Christoph Ransmayr, wo er beschreibt, wie zwei britische Uhrmacher nach Peking kommen, weil der Kaiser eine Uhr haben möchte, die die Ewigkeit misst. Das ist natürlich eine fiktive Geschichte, basiert aber auf dem Wissen, dass Qianlong, der Kaiser von China im 18. Jahrhundert tatsächlich ein Uhrensammler war. Wir sehen unter anderem Blumentopfuhren, eine Vogelkäfiguhr, Palmenuhren und chinesische Wasseruhren. Der chinesische Reiseleiter fragt mich misstrauisch, was ich denn da notiere. Mir fällt das Buch ein: "Als hundert Blumen blühen sollten" von Yue Daiyun, das die Odyssee einer revolutionären chinesischen Frau schildert (1986). Ich reagiere auch misstrauisch, denn damals sollten die Chinesen offen ihre Meinung sagen, was später gegen sie verwendet wurde.
Der Reiseleiter erzählt in der Schatzkammer des Kaisers, seinem Alterssitz, dass in der Decke eine silberne Kugel installiert ist, die wir sehen, sie würde bei einem "bösen" Kaiser auf ihn fallen. Oh, wie oft hätte sie dann schon runterfallen müssen! Die chinesischen Kaiser glaubten, vom Himmel zu kommen und nannten sich deshalb "Himmelssöhne".
Wir gehen in den Garten. Beim Mond-Fest stiegen die Konkubinen auf einen künstlichen Berg zum Pavillon auf, um nach ihren Familien Ausschau zu halten. Wenn sie erst einmal im Kaiserpalast waren, konnten sie ihre Familien nie wiedersehen.
Wir verlassen den Kaiserpalast und sehen draußen, wie Honigmelonenstücke am Stiel angeboten werden. Der Reiseleiter erzählt, dass das Halten von Privatautos gefördert werde. Jetzt sind noch viele Fahrräder unterwegs. Eine Frau mit rotem Gesichtsschleier vor dem Gesicht wegen des Wüstenwindes fährt Fahrrad, hinter ihr ein Kind auf dem Gepäcksitz. Es ist kühl. Ein Kind mit ebenfalls rotem Schleier vor dem Gesicht fährt hinter seinem Vater auf dem Fahrrad.
200,- DM verdient ein Chinese im Monat durchschnittlich in Nordchina, 2.000,- DM in Südchina. Die Wohnungen teilen die Firmen zu, die auch zum großen Teil die Mieten übernehmen. Je nach Arbeitsjahren hat man ein Anrecht auf eine größere Wohnung. Eine 2-Zimmer-Wohnung ist 25 qm groß und für 2-3 Personen gedacht. Junge Chinesen wohnen gern in den vielen neuen Hochhäusern, denn hier gibt es Küchen und Toiletten. In den Hofhäusern, wo sie früher lebten, lagen die öffentlichen Toiletten zur Straße hin. Viele alte Hofhäuser werden abgerissen. In riesigen Baustellen wird Tag und Nacht gearbeitet. Scheinwerfer der Baustellen konkurrieren diese Nacht mit einem Feuerwerk, das zum Jahrestag der Gründung der Volksrepublik abgebrannt wird.
China hat fast keine Arbeitslosen. 4-5 Leute sind für eine Arbeit, die einer schaffen könnte, eingeteilt. Zwischendurch geht man einkaufen, zum Friseur auf der Straße, bringt Kinder zu den Großeltern oder macht das Haus sauber. Ab und zu muss sich der Arbeitnehmer auf der Arbeitsstelle sehen lassen.
Wir sehen Chinesinnen mit ihren dünnen Beinen, an denen die Perlonstrümpfe ohne Strumpfhalter schlottern, wie man an den rutschenden Strümpfen erkennt.
Wir betreten nun den Tian‘anmen-Platz, Platz des Himmlischen Friedens, Ort der blutigen Studentenunruhen 1989 und des Hungerstreiks, an der Nordseite Eingang zum Kaiserpalast, Platz Westseite "Große Halle des Volkes" und "Mao Zedong-Gedenkhalle". Studenten hatten gegen die Korruption, gegen die Inflation und für Presse- und Meinungsfreiheit protestiert. Die Staatsführung sah die Ordnung in Gefahr, schlug am 4. Juni die Demonstration gewaltsam nieder, die Führung wollte das. Es gab Tote. Auf dem Platz selbst starben keine Menschen. Daher ist die Bezeichnung "Tian‘anmen-Massaker" plakativ gebraucht. Am 19. Mai kam KP-Chef Zhao Ziyang, ein Reformer, beschwor die Studenten, ihre Proteste zu beenden. Aber die Studenten wollten immer mehr. Zuletzt hatten sie sich gestritten, was sie eigentlich wollten. Sie gaben nicht nach. Wir sahen später in einer Fernsehdokumentation (arte) mit Zeitzeugen die andere Seite der Medaille. Die Toten sollen nicht damit entschuldigt werden. Die politischen Folgen waren die Entmachtung von Zhao Ziyang und eine Welle der Repression seitens der Staatsführung. Die Welt war erschüttert. Viele Touristen sagten damals ihre gebuchten Reisen ab, wie auch eine aus unserer Reisegruppe berichtet. Für lange Zeit kamen auch keine Studenten mehr nach China. Wir teilten damals die allgemeine Entrüstung.
Jetzt ist der Tian‘anmen-Platz wunderschön geschmückt mit einem Phönix, dessen Schwanz aus Blumen besteht, dem Wahrzeichen der Kaiserin. Gegenüber steht ein Drache aus Metall mit Blumen umwunden. Ein Kleinkind mit rosa gehäkelter Wollmütze, die ein silbernes Glöckchen ziert, staunt den Drachen an, das Symbol des Kaisers. Mir fällt das Buch: "Das Mädchen Orchidee" von Pearl S. Buck ein, das ich früher mal gelesen hatte. Wie Orchidee es wagte, den Kaiser anzusehen, was streng verboten war! Und wie Orchidee sich an einer gewissen Stelle Parfüm tupfte, bevor sie zum Kaiser ging!
Yongle, ein chinesischer Kaiser der Ming-Dynastie, befahl in Peking eine besondere Glocke aus Messing zu gießen mit Gold und Silber. Da Silber und Gold bei unterschiedlichen Temperaturen schmelzen, ging das nicht. Der Glockengießer hatte schon zweimal vergeblich versucht, die gewünschte Glocke herzustellen. Die Tochter des Glockengießers befragte nun einen Astrologen, der sagte, dass dieses Problem zu lösen sei, wenn sich ein junges Mädchen in das geschmolzene Metall werfen würde. Der Kaiser verlangte den Kopf des Glockengießers, wenn auch der dritte Versuch misslingen würde. Da stürzte sich Ko-Ngai, so hieß seine Tochter, in den Schmelztiegel. Die Glocke wurde gegossen. Laut Konfuzius sind Mädchen nichts wert.
Wir besuchen den Konfuzius-Tempel. Da stehen Zypressen. Eine davon soll "bösen" Ministern den Hut abnehmen, wie einmal geschehen.
Zum Mittagessen gibt es gebratenen Puffreis.
Auf der Straße sehen wir, dass Fahrräder Nummernschilder haben. Ihre Besitzer müssen Steuern dafür zahlen. Viele Fahrräder werden gestohlen. Autos sind weniger zu sehen als bei Pearl S. Buck in "Die Töchter der Madame Liang" beschrieben.
Wir besuchen eine Manufaktur, die die Handgymnastikkugeln aus Kupfer, ummantelt mit farbiger Emaille, herstellt. In der Hand gerollt, hört man helle Glockentöne. Zwei Kugeln dürfen sich bei dieser Übung nicht berühren. Das soll gut für das Herz und die Muskulatur sein. In der Manufaktur werden auch Vasen, das Symbol für Frieden und Kraniche, die ein langes Leben bescheren sollen, hergestellt. Wir sehen, wie einige Arbeiterinnen an ihrem Arbeitsplatz Pause machen, wo sie essen oder auch schlafen. Draußen steht eine Giraffe als Metallgerüst, die mit Efeu bewachsen ist.
Beim "Himmelstempel" wird Tsingtau-Bier verkauft, denn da ist gerade eine Ausstellung mit einheimischen Produkten. Jährlich zur Wintersonnenwende begaben sich einst die Kaiser dorthin, um für eine reiche Ernte zu beten. An der "Echo-Mauer" funktioniert die Akustik nicht wegen der vielen Touristen. Ich vermute, dass Michael Ende sich an dieser Stelle für die "Unendliche Geschichte" inspirieren ließ.
Hier trafen sich Jakob und Felicity aus dem Roman "Peking" von Anthony Grey. Jakob machte Felicity einen Heiratsantrag. Wir fahren an der Universität vorbei. Ob hier Yue Daiyun lehrt, die "Als hundert Blumen blühen sollten" schrieb? Die "Kleine Sampan" von Chow Chung-Cheng hat dort studiert. In "Ostwind-Westwind" von Pearl S. Buck erfahren wir, dass an dieser Uni ihr Bruder studiert hatte. Wir erreichen den Sommerpalast und trinken auf dem "Marmorschiff" Tee am Ufer des Kunming-Sees.
© Reinhild Paarmann, Juni 2025.
Zum Anfang
2025/05/31
Zum Anfang
2025/05/27
Holunderblüte am Feldrand

Foto von © Dagmar Sinn.
Zum Anfang
2025/05/24
100 Jahre »Der rasende Reporter« von Egon Erwin Kisch, 1925
Tätowierung
Egon Erwin Kisch schreibt:
"In einem Geschäftslokal am Galatakai in Konstantinopel ließ ich mir 1906 einen Excentric auf den rechten Arm tätowieren. Ich habe es getan,
1. weil ich gerade vom Militärdienst kam und mich nun tätowieren lassen konnte, wo und wie ich wollte, ohne daß mir eine Offiziersversammlung hineinzureden hatte;
2. weil ich wissen wollte, ob das Tätowieren ohne Stiefelwichse weniger schmerzhaft sei, und
3. hauptsächlich, weil mich das Plakat überzeugte. Es war englisch und deutsch.
Dieser Yankee imponierte mir! Der verstand es, seine See-Erfahrungen zu verwerten! Der kannte die Psyche der Seamen und Docker aller Nationen! Solch eine Verschwendung an Rufzeichen und Superlativen - echt amerikanisch! Es war der Entschluß eines Augenblicks, und ich stand dem ehemaligen Bootsmaat und Obertätowierer des Admiralsschiffes »Columbus« (USA) - !!Amerika!! - persönlich gegenüber. Ich bat ihn, mir seine wundervollsten Muster zu zeigen, zur freien Auswahl, nach persönlichem Geschmack so wie es auf dem Plakate stand. Zu seinem allergrößten Leidwesen hatte Herr Alfred Löwenfeld aus Proßnitz das Album vor einer halben Stunde - so ein Pech! - einem Schiffskapitän zur Ansicht geschickt. Er habe heute nur eine einzige Vorlage hier, den berühmten Negerartisten Bimbo. Ich schaute mir Bimbo an; ein widerlicher Variéteneger mit einem Maul wie ein Schimpansengesäß und mit einer Krawatte, die wie eine verfaulte Erdbeere aussah. Bevor ich noch den Versuch machen konnte, mich zu verabschieden, hatte Alfred Löwenfeld meinen Arm bereits gepackt, schon war die Kontur des ekelhaften Excentrics von der Vorlage auf meine Haut abgedruckt, eine trübe Fabriktusche aus ihrem Günther-Wagner-Fläschchen in eine Reibschale geschüttet und ein Elektrisierapparat eingeschaltet. Mit etwas, was halb Injektionsspritze, halb Hohlnadel war, vom Apparat mit Elektrizität und aus der Farbschale mit Tusche gespeist wurde, fuhr er nun den Umriß des Niggers entlang, daß Blut und Tusche nur so spritzten. Die Hose wollte er schwarz anlegen, allein ich verzichtete energisch. Dagegen nützte mein Protest nichts, als er die schwarzen Glotzaugen grün umränderte - sonst würde man doch in dem schwarzen Gesicht nicht sehen, daß es Augen sind! Er hatte recht, und ich ließ mir giftgrüne Kreise in den Arm stechen.
Während der Operation erzählte mir der alte amerikanische Bootsmaat vom Admiralsschiff »Columbus«, daß er in Proßnitz bis zum vorigen Jahr ein Kolonialwarengeschäft hatte, aber bankrott wurde. Bei Nacht und Nebel fuhr er davon, wollte nach Palästina, wo er einen Neffen vermutete. Auf der Fahrt wurde er so seekrank, daß man ihn hier in Konstantinopel ausschiffen mußte. »Na, und da habe ich einen Norweger kennengelernt, dem hier die Tätowiererei gehört hat. Ich hab mir gedacht, das wäre etwas für mich, und weil mir der Eskimo eingeredet hat, das Geschäft geht gut, hab ich ihm erzählt, ich soll in eine Exportfirma in Jerusalem als Kompagnon eintreten, aber wenn er mir sein Geschäft übergibt, trete ich ihm meines ab und noch meine Fahrkarte. Er war einverstanden, ich war mit ihm beim Notar, weil er eine regelrechte Vollmacht haben wollte, daß ich ihm meine Anteile von der Jerusalemer Firma abtrete...«
»Welche Firma haben Sie denn genannt?«
»Ich weiß es nicht mehr - irgendeine Adresse - das ist doch egal, nicht? - Kurz und gut, er ist mit meiner Schiffskarte weggefahren - zur Sicherheit habe ich noch die Anzeige gegen ihn erstattet, damit er nicht zurückkommen kann -, und ich bin hiergeblieben. Aber kein Mensch ist in den Laden gekommen - ich bitte Sie, wer ist heutzutage noch so dumm, sich tätowieren zu lassen - es war eine Pleite - der Ganef hat mich hineingelegt, nur diese rostige Maschinerie hat er mir dagelassen, mit der ich die schönste Blutvergiftung herbeiführen kann« - er stichelte gerade den verfaulten Erdbeerschlips, daß Karmin und Blut und Tusche eine schöne Schweinerei ergaben -, »denken Sie sich meinen Verdruß mit den Behörden, wenn eine von meinen Kundschaften an Blutvergiftung stirbt! Niemand wäre in den Laden hereingekommen, wenn ich nicht das Plakat hätt machen lassen - auf das fällt doch hier und da ein Trottel herein!«
Die Erschaffung Bimbos war zu Ende, es tat weh, viel mehr als eingestochene Stiefelwichse. Garantiert schmerzlos, dachte ich schmerzlich. Nach acht Tagen werde das vergehen, beruhigte mich Mister Lionsfield, ich müsse nur den Arm den ganzen Tag nach oben halten und viel Vaseline daraufschmieren. Tatsächlich ging nach längerer Behandlung durch einen hervorragenden Dermatologen die Geschwulst zurück, nur die grünen Augen werden alljährlich rezidiv. Aber gerade wegen dieser stechenden Augen - oh, wie sie stechen, ich weiß es am besten! - haben die Frauen den tätowierten Nigger so lieb. Noch nach Jahren fragen sie mich: »Was macht dein Bimbo, ist er noch immer so oft entzündet?« Ich habe solche Erkundigungen in Gesellschaft nicht gern, weil man wissen will, wer dieser Bimbo ist, und ich dann das schwarze Scheusal mit den grünen Augen herzeigen muß."
Öl auf Leinwand. Hamburger Kunsthalle.
Zum Anfang
2025/05/20

Zum Anfang
2025/05/19
Alchimia - Die Revolution des italienischen Designs
Ausstellung im Bröhan Museum Berlin bis 7. September 2025
von Dr. Christian G. Pätzold
Oggetto banale: Caffettiera (Mokkakanne), 1980. Aluminium, bemalt.
Archivio Alessandro Mendini.
Foto: Quittenbaum Kunstauktionen GmbH, München.
Im 20. Jahrhundert gab es drei wichtige Revolutionen im internationalen Design und in der Architektur: Art Nouveau (Jugendstil) um 1900, die Bauhaus-Moderne um 1920 und die Postmoderne um 1980. Das Credo der Bauhaus-Moderne war: Form Follows Function, die Funktion bestimmt die Form. Das war logisch und sehr vernünftig gedacht. Die Objekte und die Bauten der Moderne waren sachlich ohne Schnörkel und Verzierungen, auf den Zweck ausgerichtet und hatten trotz ihrer Nüchternheit doch auch eine einfache Schönheit.
Mit der Postmoderne um 1980 entstand eine radikale Anti-Moderne. Ihre gedanklichen Wurzeln hatte die Postmoderne zum Teil in der revolutionären 68er-Bewegung, in der antiautoritären Spaßfraktion. Die versteinerten Verhältnisse des Kapitalismus sollten zum Tanzen gebracht werden. Die Postmoderne war bunt wie die Pop-Art, verspielt in den Formen und eklektisch in den stilistischen Zitaten, und vor allem mit viel Witz und Humor ausgestattet, alles Eigenschaften, die der Bauhaus-Moderne weitgehend gefehlt hatten. In der Postmoderne war die Form nicht mehr eine Konsequenz der Funktion, sondern eine Konsequenz des Spaßfaktors. Die Objekte der Postmoderne haben uns in den 1980er Jahren so viel Spaß und Freude gemacht. Die postmodernen Häuser waren übereinander zusammengewürfelte Kreationen von Phantasie, die kaum noch Horizontale und Senkrechte erkennen ließen. All das war sehr lustig und völlig unlogisch.
Wir dachten damals, die Postmoderne könnte die teils recht kühle Sachlichkeit der Bauhaus-Moderne überwinden und nachhaltig zu mehr Spaß und Freude führen. Aber dem war nicht so. Die Postmoderne ereilte dasselbe Schicksal der Kurzlebigkeit wie 100 Jahre vorher schon den Jugendstil. Die Architekten und Architektinnen waren überwiegend humorlos und mieden die Postmoderne, kehrten zur Moderne zurück. Heute sieht man fast nur noch Moderne, die neu gebaut wird.
Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Moderne in Deutschland ihren Anfang nahm und die Postmoderne in Italien. Wie sich die Postmoderne in Italien entwickelte, zeigt die sehr sehenswerte Design Ausstellung im Bröhan Museum Berlin anhand vieler Objekte. Vor allem die Gruppen Alchimia mit Alessandro Mendini (1931-2019) und Memphis um Ettore Sottsass jr. (1917-2007) sind in der Ausstellung berücksichtigt. Besonders Ettore Sottsass machte die postmodernen Möbel und Einrichtungsgegenstände in den 1980er Jahren populär und auch in Deutschland erwerbbar. Die Freude war von kurzer Dauer. Nicht das ideenversprühende Memphis der Postmoderne hat sich durchgesetzt, sondern das humorlose IKEA der klassischen Moderne.
Natürlich war die Postmoderne in der Architektur und im Design international eine viel größere Bewegung, als in einer überschaubaren Ausstellung auf einer Etage gezeigt werden kann. Aber dem Bröhan Museum gelingt es, die ursprüngliche theoretische Ideenwelt und den gedanklichen Kern hinter der Postmoderne sichtbar zu machen. Das Bröhan Museum hat es über die Jahre geschafft, Arts and Crafts, Art Nouveau, Bauhaus und Postmoderne in ihren historischen und theoretischen Verästelungen und Wurzeln sichtbar zu machen. Diese große Leistung muss man erstmal schaffen. Von Morris zu Gropius zu Sottsass. Jetzt fehlt nur noch, dass das Bröhan Museum uns prophezeit, welche Revolution im internationalen Design als Nächste kommt. Auch der Katalog zur Ausstellung ist sehr zu empfehlen.
Das Bröhan Museum schreibt:
"Die Schau im Bröhan Museum ist die erste große Retrospektive dieser für das 20. Jahrhundert so wichtigen Bewegung, die mit Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, Andrea Branzi, Lapo Binazzi u.a. die wichtigsten Designer und Designerinnen der 1970er und 80er Jahre Italiens vereinte. Waren das Bauhaus und die deutsche Moderne der Meilenstein in der ersten Jahrhunderthälfte, so ist Alchimia der große Wendepunkt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.
Anders als in Deutschland erfasste die 68er-Bewegung in Italien auch das Design. In rascher Abfolge entwickelten sich in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre eine ganze Reihe von Designergruppen wie Archizoom oder Superstudio. Die 1976 von Alessandro Guerriero und seiner Schwester Adriana in Mailand gegründete Gruppe Alchimia führte die unterschiedlichen Ansätze der 1960er-Jahre zur Perfektion und zu großem internationalen Erfolg. Durch einen radikalen Bruch mit dem Funktionalismus läutete dieses Avantgarde-Kollektiv eine neue Ära des Designs ein. Mit knalligen Farben, preiswerten Materialien und einer Prise Ironie verwandelten die Designer und Designerinnen Alltagsgegenstände in provokative Kunstwerke. Alchimias Leitidee war, gefühlloser Massenproduktion individuelle und sinnliche Objekte entgegenzusetzen - selbst auf Kosten der Zweckmäßigkeit. Ihre visionäre Kraft inspirierte eine ganze Generation von Gestaltern und Gestalterinnen und machte Alchimia zur Legende der Designgeschichte. Ihr Mantra, nicht zu verzweifeln und aus der Schönheit neue Kraft und Resilienz zu schöpfen, ist heute so aktuell wie damals.
Alchimia wagte den konsequenten Schritt, ein Design jenseits der industriellen Produktion zu versuchen, das ganze Leben sollte zum Gesamtkunstwerk werden. Die Gruppe propagierte mit ihren Entwürfen eine Gegenwirklichkeit, einen anderen Entwurf der Welt. Es ist eine Welt voll Heiterkeit, Farbe und Ästhetik, die verdeutlichen soll: Eine andere Realität ist möglich."
Galerie Maurer, München.
© erede Ettore Sottsass / VG Bild-Kunst, Bonn 2025.
Foto: Quittenbaum Kunstauktionen GmbH, München.
Zum Anfang
2025/05/15
Vor 500 Jahren:
Die Schlacht bei Frankenhausen im Deutschen Bauernkrieg am 15. Mai 1525
Im deutschen Mittelalter gab es drei anerkannte Stände: Die Priester, den Adel und die Bauern. Die Bauern waren meist unfrei und Leibeigene der Adligen. Die Bauern wollten aber keine Leibeigenen von irgendwelchen Adligen mehr sein. Daher kämpften sie für ihre Freiheit. Sie waren der Ansicht, dass sie als Christen einen Anspruch darauf hätten, frei zu sein. Die adligen Ritter waren natürlich anderer Ansicht und wollten die Bauern weiter ausbeuten. Dieser Gegensatz führte letztlich zum Bauernkrieg.
Für die DDR als Arbeiter- und Bauernstaat war die Revolution der deutschen Bauern im Jahr 1525 ein sehr wichtiges historisches Datum. In der BRD dagegen wird der Freiheitskampf der Bauern weitgehend ignoriert. Es finden keine hochrangigen Gedenkveranstaltungen statt. An eine Revolution der Untertanen will man nicht erinnern.
Die entscheidende Schlacht zwischen den Bauern und dem Heer der Ritter fand am 15. Mai 1525 in Frankenhausen/Kyffhäuser in Thüringen statt. Nördlich der Stadt auf dem Weißen Berg wurden in der Schlacht die aufständischen Bauern besiegt und ihr Anführer Thomas Münzer gefangen genommen und wenig später zusammen mit anderen Revolutionären hingerichtet. Die aufständischen Bauern waren offensichtlich nicht so geübt im Krieg führen wie das Heer der Ritter. An die 6.000 Bauern sollen in der Schlacht von den fürstlichen Soldaten getötet worden sein. Es floss so viel Blut, dass noch heute ein Weg am Berg Blutrinne heißt.
Als Deutscher Bauernkrieg wird der Aufstand der süddeutschen und mitteldeutschen Bauern in den Jahren 1524/1525 bezeichnet. Bauernbewegungen und Bauernaufstände in Deutschland hatte es vereinzelt immer wieder bereits seit der Mitte des 15. Jahrhunderts gegeben. Die Bauern forderten eine Einschränkung ihrer Lasten und Dienste, die Aufhebung der Leibeigenschaft, die Freiheit der Jagd und des Fischfangs. In den Zwölf Artikeln der schwäbisch-fränkischen Bauern von 1525 waren die Forderungen der Bauern zusammengefasst. Im Verlauf des Krieges zerstörten die Bauern zahlreiche Klöster und Burgen.
In Frankenhausen erinnert heute ein großes Bauernkriegspanorama auf dem Schlachtberg an die Ereignisse. Der Panoramabau wurde zu DDR-Zeiten gebaut. Das große Panoramagemälde wurde in den Jahren 1976 bis 1987 von dem Maler Werner Tübke (1929-2004) und Kollegen auf Leinwand gemalt. Es war eine riesige Arbeit, jede Figur und jede Szene wurde von Hand gemalt. Das Bauernkriegspanorama in Frankenhausen hat mit 123 Metern Länge in einer Rotunde und 14 Metern Höhe erhebliche Ausmaße und wurde 1989 noch vor dem 9. November eröffnet.
Bauernkriege gegen die feudalen Lasten gab es damals auch in anderen Ländern Europas. Die Bauernkriege waren in keinem Land erfolgreich in dem Sinne, dass sie eine neue fortschrittlichere Gesellschaftsordnung erreicht hätten. Als Literatur zu empfehlen: Friedrich Engels, Der deutsche Bauernkrieg, Leipzig 1875 (3. Auflage, geschrieben 1850).
Anführer der Bauern in Thüringen war Thomas Münzer (Stolberg am Harz 21.12.1489 - hingerichtet bei Mühlhausen/Thüringen 27.5.1525). Er war ein revolutionärer protestantischer Theologe. Er besuchte die Klosterschule in Halle. Seit 1506 studierte er in Leipzig, seit 1512 in Frankfurt/Oder. 1520 war er Pfarrer in Zwickau, wurde aber wegen seiner revolutionären, obrigkeitsfeindlichen Anschauungen aus der Stadt ausgewiesen. Es folgte eine Wanderschaft, auf der er in Prag Verbindung mit den Böhmischen Brüdern aufnahm. Im Jahr 1523 wurde er Pfarrer in Allstedt (Sachsen-Anhalt). Zuletzt war er Prediger in Mühlhausen in Thüringen, wo er von Heinrich Pfeiffer unterstützt wurde. Er war ein Gegner Martin Luthers. Er wollte ein urchristlich-kommunistisches Reich Gottes auf Erden errichten. Seine Fahne war die Regenbogenfahne. Seine Werke sind erschienen: Politische Schriften. Mit Kommentar herausgegeben von Carl Hinrichs, Halle 1950.
Heinrich Pfeiffer, geboren als Heinrich Schwertfeger (Mühlhausen/Thüringen vor 1500 - hingerichtet zusammen mit Thomas Münzer im Heerlager Görmar bei Mühlhausen 27.5.1525) war ebenfalls ein revolutionär Theologe und Bauernführer im Bauernkrieg. Er war ursprünglich Zisterziensermönch, dann Prediger der Reformation und Mitkämpfer von Thomas Münzer.
Die Forderungen der Bauern im Bauernkrieg waren in den Zwölf Artikeln zusammengefasst. Dabei handelte es sich um eine von Sebastian Lotzer und Christoph Schappeler verfasste Schrift mit dem Titel: Die gründlichen und rechten Hauptartikel aller Bauernschaft und Hintersassen der geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, von welchen sie sich beschwert vermeinen. Die Schrift erschien im März 1525 in Augsburg und wurde noch im gleichen Jahr über zwanzigmal nachgedruckt. In ihr wurden die Forderungen der aufständischen Bauern in Schwaben in zwölf Punkten zusammengefasst. Die Zwölf Artikel waren von einem Bauernparlament in Memmingen/Ober-Schwaben im März 1525 verabschiedet worden.
Im 1. Artikel wird das Recht für die Gemeinden gefordert, ihre Pfarrer selbst zu wählen und abzusetzen.
Im 2. Artikel erklären sich die Bauern bereit, den großen Zehnt (Kornzehnt) an die Geistlichkeit zu zahlen, lehnen aber andere Abgaben wie den kleinen Zehnt (Viehzehnt) ab.
Im 3. Artikel wird die Abschaffung der Leibeigenschaft gefordert.
Im 4. Artikel wird das Recht auf Jagd und Fischfang gefordert.
Im 5. Artikel wird das Recht gefordert, im Wald Holz schlagen zu dürfen.
Im 6. Artikel wird die Rücknahme der zahlreichen Dienstverpflichtungen der Bauern gefordert.
Im 7. Artikel wird für Dienste der Bauern eine Entlohnung in Geld gefordert.
Im 8. Artikel werden gerechte Pachtzinsen für Ländereien gefordert.
Der 9. Artikel richtet sich gegen willkürliche Strafen.
Im 10. Artikel wird die Rückgabe der vom Adel angeeigneten Gemeindeländereien gefordert.
Im 11. Artikel wird die Abschaffung von Abgaben, die von Erben von Grundbesitz zu zahlen waren, gefordert.
Im 12. Artikel schließlich wird beteuert, dass man von einem der genannten Artikel ablassen wolle, wenn mit der Heiligen Schrift bewiesen werde, dass sie zu Unrecht erhoben worden seien.
Martin Luther äußerte sich zu den Artikeln in seiner Schrift Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben von 1525.
Unter dem Titel Freiheyt 1525 gibt es jetzt in der Stadt Mühlhausen in Thüringen 3 Ausstellungen zu 500 Jahren Bauernkrieg. Und im in der Nähe gelegenen Frankenhausen ist natürlich das große Bauernkriegspanorama sehenswert, mit einer Sonderschau mit Kunst der Renaissance.
Dr. Christian G. Pätzold.
Zum Anfang
2025/05/11
Einladung zur Lesung BerlinExpress #1 am Freitag 16. Mai 2025, 17 Uhr,
im Café im 1. Hof der Prinzenallee 58, Berlin Wedding.
Es lesen Frank Sorge (Brauseboy), Wolfgang Weber, Sandra Wiedemann,
Manuel Wanser, Enrico Neumann, Dr. Christian G. Pätzold und weitere Autorinnen
und Autoren.
Thema sind die wilden 1990er Jahre in Berlin.
Die Organisation macht Renate Straetling. Der Eintritt ist frei.
Zum Anfang
2025/05/07
Eduardo Saborit Pérez, 1911-1963
Cuba, qué linda es Cuba, 1959
Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda.
Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bueno.
Yo te invito a que busques por el mundo
Otro cielo tan azul como es mi cielo
Una luna tan brillante como aquella
Que se filtra en la dulzura de la caña
Un Fidel que vibra en la montaña
Un rubí, cinco franjas, y una estrella.
Un Fidel que vibra en la montaña
Un rubí, cinco franjas, y una estrella.
Cuba, qué linda es Cuba
Quien la defiende la quiere más.
Oye Cubano.
Cuba, qué linda es Cuba
Quien la defiende la quiere más.
Lindo es tu cielo, lindo es tu mar,
Y hoy eres faro de libertad
¡Mi Cuba bella!
Cuba, qué linda es Cuba
Quien la defiende la quiere más.
Lindo es tu verde cañaveral,
Las cañas cantan himnos de paz
¡Mi Cuba libre!
Cuba, qué linda es Cuba
Quien la defiende la quiere más.
Pero linda la Sierra que fue el cuartel
De los barbudos junto a Fidel,
¡Mi Cuba!
Cuba, qué linda es Cuba
Quien la defiende la quiere más.
Un Fidel que vibra en la montaña
Un rubí, cinco franjas, y una estrella.
Zum Anfang
2025/05/03
Wann wird man je verstehn ?
Sag mir, wo die Blumen sind
Wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Blumen sind
Was ist geschehn?
Sag mir, wo die Blumen sind
Mädchen pflückten sie geschwind
Wann wird man je verstehn?
Wann wird man je verstehn?
Sag mir, wo die Mädchen sind
Wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Mädchen sind
Was ist geschehn?
Sag mir, wo die Mädchen sind
Männer nahmen sie geschwind
Wann wird man je verstehn?
Wann wird man je verstehn?
Sag mir, wo die Männer sind
Wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Männer sind
Was ist geschehn?
Sag mir, wo die Männer sind
Zogen fort, der Krieg beginnt
Wann wird man je verstehn?
Wann wird man je verstehn?
Sag, wo die Soldaten sind
Wo sind sie geblieben?
Sag, wo die Soldaten sind
Was ist geschehn?
Sag, wo die Soldaten sind
Über Gräber weht der Wind
Wann wird man je verstehn?
Wann wird man je verstehn?
Sag mir, wo die Gräber sind
Wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Gräber sind
Was ist geschehn?
Sag mir, wo die Gräber sind
Blumen wehn im Sommerwind
Wann wird man je verstehn?
Wann wird man je verstehn?
Sag mir, wo die Blumen sind
Wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Blumen sind
Was ist geschehn?
Sag mir, wo die Blumen sind
Mädchen pflückten sie geschwind
Wann wird man je verstehn?
Wann wird man je verstehn?
Where Have All the Flowers Gone ?
Text von Pete Seeger, 1955.
Gesungen von Pete Seeger, Joan Baez und vielen anderen.
Sag mir, wo die Blumen sind
Text von Max Colpet, 1962.
Gesungen von Marlene Dietrich, Hannes Wader und vielen anderen.
Zum Anfang
2025/05/01
Sonnige Grüße zum 1. Mai !
Wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt ?
1978, Farbsiebdruck, 47,5 x 34 cm.
Zum Anfang
2025/04/30
Zum Anfang
2025/04/26
Wir bleiben bunt !
Zum Anfang
2025/04/24
Helge Leiberg
Wildheit im Kopf
Acryl auf Leinwand. Kunstsammlung der Berliner Volksbank.
Foto von Dr. Christian G. Pätzold.
Zu sehen in der Ausstellung MENSCH BERLIN
in der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank,
Kaiserdamm 105 in Berlin Charlottenburg, bis zum 22. Juni 2025.
Zum Anfang
2025/04/22
Roland Nicolaus
Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm

Öl auf Leinwand. Kunstsammlung der Berliner Volksbank.
Foto von Dr. Christian G. Pätzold.
Zu sehen in der Ausstellung MENSCH BERLIN
in der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank,
Kaiserdamm 105 in Berlin Charlottenburg, bis zum 22. Juni 2025.
Vom 9. Juli bis 31. August 2025 in Wien, Bank Austria Kunstforum Wien.
"Die Sammlung der Stiftung Kunstforum der Berliner Volksbank, gegründet 1985, umfasst über 1.500 Werke von rund 200 Künstler:innen. Der Schwerpunkt liegt auf gegenständlicher deutscher Kunst nach 1950, insbesondere vor und nach der bewegten Zeit der Wiedervereinigung in und um Berlin. Aus diesem großen Schatz wird die 40 Jahre - Jubiläumsausstellung unter dem Titel MENSCH BERLIN schöpfen. So werden neben den Highlights der Sammlung auch weniger oft gezeigte Werke ihren Platz finden - freuen Sie sich auf spannende Wiederentdeckungen.
Die Ausstellungen zeigen Werke von:
Horst Antes, Elvira Bach, Annemirl Bauer, Rolf Biebl, Norbert Bisky, Christa Böhme, Karol Broniatowski, Gudrun Brüne, Manfred Butzmann, Luciano Castelli, Fritz Cremer, Christa Dichgans, E.R.N.A., Rainer Fetting, Wieland Förster, FRANEK, Ellen Fuhr, Klaus Fußmann, Hubertus Giebe, Sighard Gille, Hans-Hendrik Grimmling, Clemens Gröszer, Waldemar Grzimek, Bertold Haag, Angela Hampel, Bernhard Heisig, Heinz Heisig, Burkhard Held, Werner Heldt, Sabine Herrmann, Barbara Keidel, Klaus Killisch, Carl-Heinz Kliemann, Gregor-Torsten Kozik, Hans Laabs, Roland Ladwig, Helge Leiberg, Via Lewandowsky, Werner Liebmann, Rolf Lindemann, Markus Lüpertz, Wolfgang Mattheuer, Harald Metzkes, Helmut Middendorf, Roland Nicolaus, Dietrich Noßky, Barbara Quandt, Erich Fritz Reuter, Hans Scheuerecker, Cornelia Schleime, Ludwig Gabriel Schrieber, Willi Sitte, Gerd Sonntag, Hans Stein, Werner Stötzer, Strawalde, Ursula Strozynski, Rolf Szymanski, Christian Thoelke, Werner Tübke, Hans Uhlmann, Hans Vent, Ulla Walter, Trak Wendisch, Jürgen Wenzel, Bernd Zimmer und viele mehr!"
Zum Anfang
2025/04/18
Angelika Becker
"Wir arbeiten in einem Szenario der Kriegswirtschaft" -
Die aktuelle Lage in Kuba
Im Herbst 2024 schaffte es Kuba mehrfach in die deutschen Nachrichten: Hiobsbotschaften wie die tagelangen landesweiten Stromausfälle, der Durchzug der Wirbelstürme Oscar in Guantánamo mit acht Todesopfern und Rafael im Westteil der Insel sowie wenig später ein Erdbeben vor der Küste der Provinz Granma lenkten die Aufmerksamkeit kurz auf die betroffenen Gebiete.
Anhaltende Wirtschaftskrise
Doch wie geht es den Menschen hinter Meldungen wie diesen? Kuba durchlebt nunmehr das vierte Jahr einer anhaltenden Wirtschaftskrise. Der massive landesweite Stromausfall vom 18. bis 20. Oktober 2024 ist dabei symptomatisch: Der Mangel an Brennstoff führte zu einer Unterversorgung der Kraftwerke, die - ohnehin überaltert, überlastet und unzureichend gewartet aufgrund fehlender Ersatzteile infolge fehlender Devisen - die Grundlast nicht mehr bereitstellen konnten. Die Gründe für die vielfältigen Mängel sind dabei großteils in der US-Blockade zu suchen. Kuba konnte Überweisungen zur Bezahlung der Kraftstoffimporte nicht tätigen - nicht etwa durch fehlende Liquidität, sondern wegen der Weigerung zahlreicher internationaler Banken, Transaktionen durchzuführen. Denn Kuba steht seit 2021 auf einer US-Liste von Ländern, die angeblich den internationalen Terrorismus fördern. Die Situation ist grotesk. Tanker drehen teilweise wieder mit ihrer Lieferung ab, weil eine Überweisung nicht möglich ist, oder aber die Bezahlung erfolgt wie in Mafiafilmen über Koffer voller Bargeld.
Trumps Wiederwahl verheißt nichts Gutes
Der Herbst 2024 hatte es auch politisch in sich. Mit der Wiederwahl Donald Trumps zum US- Präsidenten steht zu befürchten, dass er versuchen wird, Kuba endgültig in die Knie zu zwingen. Denn er war es, der in seiner ersten Amtszeit zusätzlich zur Blockade weitere 243 Zwangsmaßnahmen erließ, die den US-Wirtschaftskrieg gegen alle Einkommensquellen der Insel unbarmherzig verschärfen. Und er war es auch, der Kuba kurz vor der Machtübergabe an seinen Nachfolger Biden erneut auf die US-Terrorliste setzte. Biden beließ es dabei.
Die Lage in Kuba ist bereits jetzt äußerst angespannt. Kubas Ministerpräsident Manuel Marrero beschreibt sie als Kriegswirtschaft. Die Hoffnungen der Bevölkerung auf eine schnelle Erholung nach der Pandemie schwinden angesichts wachsender internationaler Spannungen. Für das Jahr 2023 verzeichnete man erneut einen Rückgang des Bruttosozialprodukts um 1,9 %. Die Bilanz für das erste Halbjahr 2024 dürfte ähnlich ausfallen. Hinzu kommt: In den vergangenen drei Jahren schrumpfte die Bevölkerung um 10,1 %, sie liegt jetzt bei 10 Mio. Menschen.
Ist dies tatsächlich die Schuld der Regierungspolitik, wie von US-finanzierten exilkubanischen Gruppen immer wieder behauptet wird? Die Situation wird in Kuba nicht beschönigt. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, Ministerrat und Nationalversammlung tagen öffentlich, und auch in der Wissenschaft werden Maßnahmen diskutiert.
Schwieriger Alltag
Für die kubanische Bevölkerung sind die gestiegenen Preise für Waren des täglichen Bedarfs das größte Problem: Die normierte Grundversorgung, weitgehend aus Importwaren mit gestiegenen Weltmarktpreisen bestehend, kann nicht immer pünktlich zur Verfügung gestellt werden. Staatliche Einkommen und Renten reichen effektiv nicht aus. Dem Staat mangelt es an Bargeld und Devisen, was den informellen Wechselkurs anheizt und notwendige Modernisierungen verhindert. Auch deshalb arbeitet ein Teil der Staatsbetriebe defizitär.
Die wirtschaftsbedingte Migration sorgt für einen Arbeitskräftemangel in allen Bereichen; Ausfälle in der Energieversorgung und im Transportwesen unterbrechen die Produktionsabläufe. Das beeinträchtigt auch die landwirtschaftliche Produktion. Die wenigen Devisen werden im nichtstaatlichen Sektor überwiegend für Konsumgüter und nicht für Betriebsmittel ausgegeben. Der Devisenmangel sorgt für große Probleme auch bei der medizinischen Versorgung, da sich geplante Einnahmen aus Tourismus und Exporten nicht wie geplant realisieren. Das Haushaltsdefizit steigt, Auslandsschulden können kaum bedient werden. Im vierten Jahr der Rezession geht den Menschen langsam die Puste aus, die Hoffnung auf eine rasche Verbesserung des Alltags schwindet. Auch Korruption und Spekulation greifen um sich.
Stabilisierung der Wirtschaft
A und O bleiben weiterhin die Reduzierung des Haushaltsdefizits und die Erhöhung der Produktion. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel wandte sich im Juli 2024 in deutlichen Worten an das Zentralkomitee: "Unser Volk verlangt Ergebnisse, und die sind wir ihm schuldig." Es gelte, "mit Willen, Anstrengung und (Selbst)Kritik negativen Tendenzen zu begegnen (...) und zu ergründen, was falsch gemacht wird und warum Maßnahmen nicht die erwarteten Ergebnisse bringen, um Trägheit und Routine zu durchbrechen und das lähmende Jammern zu vertreiben."
Der Bevölkerung müssten dabei die getroffenen Maßnahmen erklärt, die Ziele klar definiert, die Verantwortlichen gut vorbereitet und mit einer politischen, materiellen und finanziellen Sicherheit begleitet werden. Es müsse einen Zeitplan für die Umsetzung geben und eine Kontrolle für Korrekturen, Anpassungen und das notwendige Feedback.
Aktivitäten für 2025
Die Deviseneinnahmen sollen mit einer Neuordnung des Devisenmarktes erhöht und die Wechselkurse stärker kontrolliert werden. Verhandlungen mit Lieferanten sollen die stabile Versorgung mit Gütern absichern. Herausforderungen liegen jedoch weiterhin in der zuverlässigen Zahlung, der Neuverhandlung der Auslandsschulden, im Aufbau von Geschäfts- und Kreditbeziehungen mit ausländischen Unternehmen und der Stärkung des elektronischen Handels.
Es gilt, die Binnenproduktion unter optimierter Ausnutzung vorhandener Kapazitäten und effektiverer Bodennutzung zu steigern. Darauf zielen eine verstärkte Abstimmung mit nichtstaatlichen Erzeugern, mehr kommunale Selbstversorgung und die Erwirtschaftung von Devisen durch Export ab. Niedrigere Zölle sollen die Einfuhr von Produktionsmitteln ankurbeln, wogegen Zölle für die Einfuhr von Fertigprodukten, die im Land selbst herstellbar sind, steigen. Ein Finanzierungsmechanismus für die Lebensmittelproduktion ist geplant ebenso wie Preisobergrenzen für bestimmte Produkte des täglichen Bedarfs.
Die Begrenzung des Haushaltsdefizits von gegenwärtig 18 % wird durch eine konsequente Erhebung von Steuern angestrebt. Die Subventionen für die Grundversorgung der Familien werden angepasst und zielgerichtet bedürftigen Personen ausgereicht. Preise für Brennstoffe und Flüssiggas werden aktualisiert, Stromtarife für Großverbraucher um 25 % angehoben. Es gibt neue Tarife für die Personenbeförderung.
Um die Beschäftigungslage zu verbessern, werden neue Arbeitsplätze und regionale Arbeitsvermittlungen geschaffen. Je nach Einnahmen können Löhne flexibilisiert werden. Lohnanreize gelten vor allem der Landwirtschaft und dem Bildungswesen.
Zwar bleibt der sozialistische Staatsbetrieb wichtigster Wirtschaftsakteur, doch wird die Unterstützung aus dem Staatshaushalt stärker gestaffelt. Betriebe erhalten mehr Autonomie. Die Gründung staatlicher Klein- und mittleren Betriebe wird gefördert, die Möglichkeiten nichtstaatlicher Akteure erweitert. Eine präzisere Rechtsnorm und die Einführung einer Umsatzsteuer sollen Steuerhinterziehung und Liquiditätsverschleierung vorbeugen sowie Geschäftsbeziehungen und Kreditnahme bei ausländischen Unternehmen offenlegen.
Berücksichtigung bei der Gestaltung von Reformen finden außerdem die demographische Entwicklung, die Einbindung von Menschen mit Behinderungen und eine effizientere Regierungstätigkeit durch Abbau von Bürokratie. Die US-Blockade nicht als Ausrede zu nutzen, um aus eigener Kraft keine möglichen Veränderungen anzustoßen, darauf hatte Präsident Díaz-Canel schon im Oktober 2023 hingewiesen: "Die größte Forderung an uns muss darin bestehen, aus eigener Kraft, mit unserem eigenen Talent, unseren eigenen Fähigkeiten und mit unserem Potenzial mehr zu produzieren. Uns bleibt kein anderer Ausweg, denn es gibt keine magischen Maßnahmen, die von einem Moment auf den anderen die gegenwärtige Situation im Lande kurzfristig ändern könnten."
Perspektiven bis 2030
Im Juli 2024 beschloss die Nationalversammlung einen Zeitplan zur Wiederbelebung der Wirtschaft bis 2030. Darin wird der Bürokratie und Langsamkeit der Kampf angesagt und die soziale Verantwortung der Unternehmen auch des privaten Sektors betont. Unmissverständlich wird klargestellt, dass die Einhaltung des Arbeitsgesetzes, das Verbot informeller Beschäftigung, eine ehrliche Steuerzahlung und eine transparente Buchhaltung bindend für alle Wirtschaftsakteure sind.
Mit dem reformierten Migrations- und Staatsbürgergesetz werden die Rechte von Kubanern, die im Ausland leben, aber auch die Wohnsitznahme von Ausländern in Kuba, erheblich erweitert. Ein neues Kommunikationsgesetz verpflichtet alle staatlichen Stellen zu umgehender und tiefgründiger Information als Voraussetzung für eine demokratische Teilhabe der Bürger. Erstmals wird Werbung zugelassen und als Finanzierungsmittel von Medien geregelt.
Der Kampf gegen Korruption und Spekulation steht ganz oben auf der Agenda, da Fälle von Schiebereien größeren Ausmaßes aufgedeckt wurden. Verfehlungen von Funktionären und Kadern werden deshalb streng geahndet. Bei diesem sensiblen Thema ist sich die Staats- und Regierungsführung sehr bewusst, dass das Zulassen solcher Erscheinungen einen Verfall der sozialistischen Moral und tendenziellen Werteverlust einleitet. Gerade die wachsende soziale Ungleichheit und Armut durch unzureichende Löhne und Renten, Teuerungen und Inflation müssen deshalb künftig noch stärker adressiert werden.
Aufgaben der Solidaritätsbewegung
Die Solibewegung muss in ihren Anstrengungen, über die Lage in Kuba, die aggressive US-Politik und die extraterritorialen Auswirkungen aufzuklären, eine breitere Öffentlichkeit inklusive politischer Entscheidungsträger und Medien erreichen. Denn die feindseligen Sanktionierungen verletzen neben Kubas auch unsere eigene Souveränität.
Genauso wichtig ist es, auch über die Errungenschaften dieses kleinen Landes zu berichten, das dafür kämpft, seinen sozialistischen Weg zu gestalten. Kuba kann uns Hoffnung geben für unsere eigenen Kämpfe für eine gerechtere Welt.
Unblock Cuba! Schluss mit der Blockade, damit Kuba seine Bevölkerung und Gesellschaft frei von Einmischung entwickeln kann! Kuba braucht dafür unsere politische und materielle Solidarität - sei es durch Spenden, lokale Projekte oder Reisen.
© Angelika Becker, im Vorstand des Netzwerk Cuba e.V., April 2025.
Zum Anfang
2025/04/14
Das Protestcamp gegen Abschiebungen auf dem Oranienplatz in Berlin Kreuzberg
Fotos von Dr. Christian G. Pätzold, 9. März 2025




Zum Anfang
2025/04/12
Dagmar Sinn
Frohe Ostern
Frühling naht mit Blumen, Licht
ohne Frühstücksei gehts nicht.
Ostern hat daher das Huhn
jedes Jahr sehr gut zu tun.
Doch man hört aus USA -
ein Unglück, das noch nie geschah -
es grassiert Geflügelpest,
gibt den braven Tiern den Rest.
Mangelware treibt den Preis,
Trump wird jetzt ein wenig heiß.
Flugs kommt ihm die Patentidee:
kauft Eier made in Germany!
Doch auch wir müssen importieren
und dürfen keine Zeit verlieren.
Old Europe biegt sich jetzt vor Lachen,
mal sehn was nun die Amis machen!
Und wir erfinden Eierzoll,
Zoll gegen Zoll, das wäre toll...
© Dagmar Sinn, April 2025.
Zum Anfang
2025/04/10
Matsuo Basho, 1644-1694
Uralter Teich.
Ein Frosch springt hinein.
Plop.
(Das berühmte Frosch-Haiku des japanischen Dichters Matsuo Basho ist vielleicht
das kürzeste Gedicht der Weltliteratur)
Zum Anfang
2025/04/06
Tagebuch 1974, Teil 81: Chiang Rai - Lampang
von Dr. Christian G. Pätzold

Quelle: Wikimedia Commons.
26. Januar 1974, Chiang Rai, Sonnabend
Wir waren jetzt in Chiang Rai, der nördlichsten Provinzhauptstadt von Thailand, und damit wieder zurück im Königreich Thailand. Das Lebensgefühl in Thailand war wesentlich entspannter und ziviler als im Bürgerkriegsland Laos.
Wir sind mit dem Manager einer Tabakfabrik zusammengetroffen. Er sagte uns, dass er 10.000 Baht (etwa 1.500 DM) im Monat verdiene, was sehr viel war für thailändische Verhältnisse. Er hatte aber keine Pensionsversicherung für das Alter, obwohl Tabak ein Staatsmonopol war. Seine Frau arbeitete als Krankenschwester. Für seine beiden Söhne, die in Deutschland und den Philippinen studierten, musste er viel Geld ausgeben. Sein Haus bekam er von der Firma gestellt. Er hatte eine Haushälterin beschäftigt. Haushälterinnen verdienten in der Regel 200 bis 300 Baht (etwa 40 DM) im Monat mit oder ohne Essen. Auf dem Bau verdienten die Arbeiter etwa 10 Baht (1,50 DM) pro Tag. Der Tabakmanager hat uns zum Essen eingeladen und uns anschließend die Trockenhäuser für den Tabak gezeigt. Die Frischblätter wurden nach Größen und Qualitäten sortiert und dann 80 bis 100 Stunden bei von 35 Grad Celsius auf 75 Grad Celsius ansteigender Temperatur in Backsteinhäusern getrocknet. Geheizt wurde mit Holz. 1 Kilogramm grüne Blätter brachten dem Farmer 0,80 bis 1,80 Baht, 1 Kilogramm getrocknete Blätter brachten bis zu 26 Baht. Die Farmer sollten selbst Trockenhäuser bauen, um die Produktion zu steigern. Die Keimlinge wurden von der Fabrik an die Bauern geliefert, ebenso Düngemittel. Dafür mussten die Bauern die Tabakblätter auch wieder an die Kompanie verkaufen. Es gab eine Zigarettenfabrik in Bangkok für die Herstellung von Thaizigaretten, die teilweise auch US-amerikanischen Tabak verwendete. In Thailand produzierte Zigaretten wurden nicht exportiert.
Am Abend hatten wir ein Gespräch mit einem Installationsingenieur aus Deutschland, der für die Elektrifizierung der Provinz Chiang Rai zuständig war. Diese Elektrifizierung wurde vom deutschen Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Erhard Eppler (SPD) mit einem Kredit von 10 Millionen DM finanziert. Die ersten 10 Jahre war der Kredit zinslos, die nächsten 10 Jahre lag der Zins bei 2 Prozent. Aufträge wurden international ausgeschrieben, daher ging nur ein Auftrag für 7 Antennen im Wert von 80.000 DM nach Deutschland.
27. Januar 1974, Chiang Rai - Lampang, Sonntag
Wir haben Johannes und Elke aus der benachbarten Stadt Lampang getroffen und sind mit ihnen hingefahren. Bis zur Hälfte der Strecke war das Land flach, dann kamen Berge, in denen Kommunisten sein sollten. Abends sind wir in Lampang mit zwei Mitarbeitern vom Peace Corps Essen gegangen.
28. Januar 1974, Lampang, Montag
Heute hatten wir mal einen lässigen Tag. Wir sind über den Markt in Lampang gebummelt und haben 1 Kilo Mandarinen für 6 Baht (etwa 80 Pfennig) gekauft. Orchideenpflanzen konnte man für 10 bis 30 Baht das Stück kaufen, viele Leute hatten die Pflanzen in ihren Gärten.
29. Januar 1974, Lampang, Dienstag
Mit Dan von der Organisation CUSO (Canadian University Students Overseas) sind wir heute zu seinem landwirtschaftlichen Projekt in einem Dorf in der Nähe von Lampang gefahren. Er hat Experimentierfelder mit Erdnüssen, Sojabohnen, Mais (süß und supersüß) sowie Sonnenblumen anlegen lassen, um verschiedene Anpflanzungsarten und Düngemittel zu testen. Die Beete wurden bewässert und zwar durch ein großes Bewässerungsprojekt bei Lampang mit 2 großen Dämmen. "They think I'm a stupid falang, but mostly they do what I tell them", sagte er über das Verhalten der Bauern, da er auf den Feldern manchmal viel mehr Platz ungenutzt ließ als üblich.
In dem Dorf wurde auch Papier hergestellt. 10 Bogen Papier verkauften sie für 2,50 Baht (etwa 30 Pfennig). Ein Mädchen sagte, dass ihr die Arbeit nicht gefällt, sie will lieber auf dem Markt etwas verkaufen, da ist mehr Abwechslung. Überall im Dorf waren die Holzrahmen mit den Papierbögen zum Trocknen aufgestellt. Das Papier wurde also ganz traditionell handgeschöpft hergestellt. Ich hatte Zweifel, ob sich diese traditionelle Produktionsmethode gegen die großen Papierfabriken mit ihren großen Maschinen behaupten könnte. Ansonsten schienen die Bauern ihr Auskommen zu haben, die Gegend war fruchtbar.
© Dr. Christian G. Pätzold, April 2025.
Zum Anfang
2025/04/02
Tagebuch 1974, Teil 80: Ban Houei Sai (Laos) - Chiang Rai (Thailand)
von Dr. Christian G. Pätzold

Sieben nach Edelsteinen.
Foto von Dr. Christian G. Pätzold, 24. Januar 1974.
23. Januar 1974, Luang Prabang - Ban Houei Sai, Mittwoch
Heute wollten wir von der alten laotischen Königsstadt Luang Prabang zur Stadt Ban Houei Sai an der thailändischen Grenze fliegen. Fliegen deshalb, weil der Landweg wegen des Bürgerkriegs in Laos nicht möglich war. Wir hatten auch schon ein Flugticket für heute gekauft. Morgens war ich im Royal Air Lao Office, wo mir eine Beschäftigte sagte, dass erst nächste Woche ein Flug nach Ban Huei Sai gehe. Na prima. Wir sind trotzdem zum Flughafen gefahren und haben uns erkundigt. Dort sagte man uns, dass von Royal Air Lao nur 2 Flüge nach Vientiane gingen. Wir bekamen mit, dass einige Ausländer zum benachbarten Militärstützpunkt fuhren, wohin wir uns auch aufmachten. Dort gab es 4 Hubschrauber, die ab und zu patrouillierten. Außerdem einen Propellerbomber mit leeren Aufhängevorrichtungen, der das Landen übte. Ein Botschaftsflugzeug "United States of America" landete. Die Ziegen am Rollfeld grasten friedlich in der Morgensonne. Dann sagte mir ein Mann vertraulich, dass das Militärflugzeug 545 nach Ban Huei Sai um 11 Uhr fliegt. Ich fragte ihn auf Französisch, ob man mitfliegen könne. Er sagte, ich müsste den Kommandanten der Militärbasis fragen. Ich lief also über die Rollbahn und fragte den Kommandanten auf Französisch, ob man mitfliegen könne. Der Kommandant war sehr freundlich, bot mir einen Stuhl an und fragte, ob ich Lao spreche. Ich verneinte. Darauf gab er mir einen Zettel für den Transportchef und ließ mich mit einem Jeep hinfahren. Der Transportchef fragte nach unseren Namen und setzte uns auf die Liste. Ich holte meine Reisepartnerin und unsere Rucksäcke und wir bestiegen den Laderaum des Flugzeugs zusammen mit Soldaten und laotischen Bauern. Das Flugzeug entwickelte einen mächtigen Krach und in 1 Stunde waren wir in Ban Houei Sai.
Der Flug im Laderaum eines klapprigen Militärflugzeugs der laotischen Regierungstruppen war schon recht abenteuerlich. Ich glaube ich kann den Flug als 9. kritischen Moment meiner Weltreise verbuchen.
In Ban Houei Sai war sofort die thailändische Nähe zu spüren, auf der anderen Seite des Mekong lag ja Thailand, man konnte in der Stadt mit thailändischem Baht bezahlen. Wir haben ein Hotel für 1.000 Kip (3 DM) gebucht. Ich habe eine Postkarte nach Berlin abgeschickt. Der Postbeamte hat uns bereitwillig einen Stadtplan von Ban Houei Sai gezeichnet. Heute war Chinesisches Neujahr und im Royal Air Lao Office waren alle betrunken und riefen "Happy New Year", so dass wir nicht das Geld für unseren nicht stattgefundenen Flug mit Royal Air Lao zurückverlangen konnten. Wir gingen etwas in der Stadt spazieren und noch hoch zur Pagode, wo wir auf einen kommunistischen Studenten trafen, mit dem wir uns unterhielten.
24. Januar 1974, Ban Houei Sai, Donnerstag
Morgens sind wir zu einer Saphirmine nahe Ban Houei Sai gefahren, in der Männer aus tiefen Löchern Erde rausschaufelten und sie dann mit Sieben im Fluss wuschen. Sie haben nur schwarze Edelsteine gefunden. Wir haben mit einem jungen Mann gesprochen, der ganz wenig Englisch sprechen konnte.
Nachmittags haben wir doch noch das Geld für unser Flugticket von Royal Air Laos zurückbekommen, minus 10 Prozent. Dann waren wir auf der Pagode, wo wir uns mit einem jungen Mönch auf Französisch unterhalten haben. In seiner Schule wurde alles auf Französisch unterrichtet. Abends haben wir noch einen thailändischen Film gesehen, in dem ein armer Bauersohn einen Doppelgänger in einer reichen Familie in Bangkok hatte.
25. Januar 1974, Chiang Rai, Freitag
Am Morgen haben wir Laos verlassen und sind mit dem Boot über den Mekong nach Thailand übergesetzt, für 3 Baht (50 Pfennig). Es war nicht leicht, den laotischen Abfertigungsbeamten zu finden, der in der frischen Luft am Ufer des Mekong an einem Holztisch saß und auf Kunden wartete. Für die Einheimischen gab es keine Grenzkontrolle, auch zwischen Thailand und Burma nicht. Jetzt kamen gerade 13.000 Menschen von den Bergstämmen nach Thailand hinüber, da in Burma Unruhen ausgebrochen waren. Wir waren jetzt im Goldenen Dreieck von Thailand, Laos und Burma, das angeblich deswegen golden heißt, weil früher das Heroin mit Gold bezahlt wurde.
Auf der thailändischen Seite des Mekong in Chiang Khong mussten wir erst eine Viertelstunde rumlaufen, bis wir den Grenzbeamten gefunden hatten. Wir wollten ja schließlich unsere Einreise im Pass dokumentiert haben. Sicher ist sicher. Der Grenzbeamte meinte. "Alles wird Bangkok mitgeteilt." Das war beruhigend.
In Chiang Rai hatten wir die Adresse von Herbert Pledel vom Deutschen Entwicklungsdienst (DED), den wir in der Boys Trade School angetroffen haben und bei dem wir übernachten konnten. Er war Automechaniker und hat versucht, uns Schafskopf beizubringen. In meiner Jugendzeit gab es ein paar Versuche, mir Spiele wie Schach, Skat oder Poker beizubringen, aber all diese Spiele haben mich nicht interessiert und ich habe die Spielregeln schnell vergessen. Ich hatte keine Lust darauf, als Gewinner oder Verlierer dazustehen und meine Zeit mit etwas Sinnlosem zu verschwenden. Er hatte 2 Kaninchen und Fische im Badezimmer.
© Dr. Christian G. Pätzold, April 2025.
Zum Anfang
2025/03/31
Zum Anfang
2025/03/29
Dagmar Sinn
Hundewetter
Ach wie war es gestern schön:
Sonnenschein, spazieren gehn.
Winters Schokoladenseite,
und wie ist das Wetter heute?
Menschen, dick verhüllt, mit Hund
schleichen über nassen Grund.
Kälte kriecht, ist das gesund?
Und die Grippe geht jetzt rund.
Nebel unser Land verhüllt,
kahle Bäume, trübes Bild.
Bock auf nichts, bin abgeneigt,
mein Bedarf an Trüffeln steigt.
Ein Kakao und ein Stück Kuchen,
will die gute Laune suchen.
Auf dem Markt der Metzgerstand
endlich meinen Beifall fand.
Gulasch, Wurst und was vom Schwein
kaufe ich begeistert ein.
Schwirre damit in die Küche,
Ort für deft'ge Wohlgerüche.
Rest des Tages ist gerettet,
Fleisch kocht und brät und wird gefettet.
Oh gute-Laune-Kalorie -
es gibt sie und ich liebe sie!
© Dagmar Sinn, März 2025.
Zum Anfang
2025/03/26
Baum des Jahres 2025: Die Amerikanische Rot-Eiche (Quercus rubra)
von Dr. Christian G. Pätzold

Histoire des arbres forestiers de l'Amerique septentrionale, 1812, Tafel 26.
Quelle: Wikimedia Commons.
Die aus dem Osten von Nordamerika stammende Rot-Eiche (Quercus rubra) ist zum Baum des Jahres 2025 in Deutschland gewählt worden. Sie wurde angeblich zuerst im 17. oder 18. Jahrhundert als Zierbaum in Parks nach Europa gebracht, denn ihre dekorativen spitzen Blätter unterscheiden sich von den europäischen Eichenarten und ihre Herbstfärbung ist spektakulär rot. Inzwischen ist sie überall in Deutschland als Zierbaum zu finden und wird auch in kleinem Umfang forstwirtschaftlich angebaut. Im Wald in Deutschland ist sie mit weniger als 1 Prozent vertreten.
Die Rot-Eichen wachsen relativ schnell, werden bis zu 35 Meter hoch und können 400 Jahre alt werden. Das Holz der Rot-Eiche wird als Bauholz und als Furnierholz genutzt. Daher ist der Anbau der Rot-Eiche auch wirtschaftlich interessant.
Es wird darüber diskutiert, ob die Amerikanische Rot-Eiche als invasive Art in Europa eingestuft werden soll. Das würde bedeuten, dass ihre Ausbreitung eingeschränkt werden sollte. Dagegen spricht, dass sich die Rot-Eiche von selbst kaum rasant ausbreitet. Außerdem scheint sie den Klimawandel besser zu verkraften als die heimischen Eichenarten (höhere Trockenstresstoleranz), so dass sie für die Erhaltung des Waldes wichtig werden könnte. Auch die einheimische Flora und Fauna scheint sie nicht negativ zu beeinflussen.
Zum Anfang
2025/03/22
Affogato al caffè
von Dr. Christian G. Pätzold

Die Espressomaschine wird gerade 125 Jahre alt und da viele von uns sich hauptsächlich mit Espresso am Leben halten, soll an ihn erinnert werden. Um 1900 in Mailand ließ Luigi Bezzera die erste Maschine für caffè espresso patentieren. Dabei wird Wasser mit hohem Druck durch das Kaffeemehl gepresst, was einen konzentrierten Kaffee mit besonderem Aroma ergibt. Der italienische Name Espresso soll von den englischen Express Dampflokomotiven stammen, die im 19. Jahrhundert die Gemüter bewegten. Express bedeutete Schnellzug, und tatsächlich wird der Espresso in der Maschine auch recht schnell produziert.
Die Kaffeebohne wird für den Espresso stärker geröstet als für den herkömmlichen Kaffee. Das trifft auf den Mailänder Espresso zu, beim sizilianischen Espresso wird die Bohne noch stärker geröstet. Dadurch entsteht ein starker Kaffee, der aus kleinen Porzellantassen getrunken wird, seltener aus einem Glas. Der klassische Espresso wird schwarz getrunken, ohne Milch. Manche trinken ihn mit Zucker, andere ungesüßt. Jedenfalls liegt meist ein kleiner Löffel auf der Untertasse. In guten Espressobars wird der Espresso mit einem Glas Leitungswasser serviert.
Der Espresso ist dank des Koffeins ein effektiver Muntermacher für zwischendurch und wird in Unmengen in Büros getrunken, besonders in Süd-Europa und in Süd-Amerika. In Deutschland heißt der Espresso Espresso, in Italien Caffè, in Frankreich Café und in Österreich Mokka.
Beim Espresso gibt es eine große Menge Variationen. Beliebte Espressi mit Milch sind Cappuccino, Latte macchiato und Caffè Latte.
Der Cappuccino besteht aus einem Espresso, auf den eine Haube von etwas geschäumter Milch gegeben wird. Der Name des Cappuccino soll von der Kleidung der Kapuzinermönche stammen.
Die Latte macchiato ist ein italienisches Kindergetränk aus viel warmer Milch, in die etwas Espresso gemischt wird.
Caffè Latte ist der herkömmliche Milchkaffee, auf Französisch Café au lait, der oft zum Frühstück getrunken wird, traditionell aus einer Schale. Beim Milchkaffee sind Kaffee und Milch im Verhältnis 1 : 1 vermischt.
Der Affogato oder Affogato al caffè, italienisch für ertrunken im Kaffee, ist eine Mischung zwischen Nachspeise und Getränk. Es werden eine Kugel Vanilleeis in einer Espressotasse und der Espresso in einem Glas serviert. Der Espresso wird dann über das Vanilleeis gegossen, das mit einem kleinen Löffel gegessen wird. Der restliche Espresso wird dann getrunken. An Stelle der Kugel Vanilleeis kann auch Nusseis oder Schokoladeneis verwendet werden. In einer weiteren Variation wird ein Schuss Amaretto (Persiko), Likör mit Aprikosenkernöl, hinzugefügt. Dolce vita. Eine paradiesische Komposition. Oh ! Ah ! Schlabber. Schlürf.
Zum Anfang
2025/03/18
Reinhild Paarmann
Über sieben Brücken
Über sieben Brücken
musst du geh'n*, hoffentlich
sind sie nicht marode.
zelten Menschen in Gaza,
Mehlsäcke mit Würmern
hängen oben an Stangen,
ihre Häuser zerstört,
nachts kam das Wasser. "Fast
wären wir ertrunken",
sagt ein Mädchen, Brücken
zum Frieden zerbombt,
wohin kannst du geh'n?
*Karat
© Reinhild Paarmann, März 2025.
Zum Anfang
2025/03/14
Was ist Krämerlatein ?
von Dr. Christian G. Pätzold
Wir betreten das Gebiet der Sprachwissenschaft. Der Duden gibt als Bedeutung Kauderwelsch und Händlersprache an. Im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) bekommt man die Hinweise Rotwelsch, Gaunersprache, Breyeller Händlersprache (Henese Fleck), Geheimsprache, Frickhöfer Sprache, Hausierersprache. In der Wikipedia erhält man zum Rotwelsch weitere Hinweise. Es handelt sich um Sondersprachen oder Dialekte gesellschaftlicher Randgruppen, etwa Bettlersprachen, Vagantensprachen (fahrendes Volk), das Jenische (der fahrenden Bevölkerungsgruppen), Kriminellensprachen, Zigeunersprachen, Argot (Soziolekte und Geheimsprachen in Frankreich).
Das Wort Krämer ist ein altes Wort für Händler. Es stammt von dem alten Wort Kram, mit dem Handelsware bezeichnet wurde. In dem Wort Krämerlatein sind aber nicht so sehr die stationären Händler gemeint, die ein festes Ladengeschäft in einer Stadt besaßen. Gemeint sind die ambulanten, fahrenden Händler, die durch die Lande von Dorf zu Dorf zogen und ihre Waren in den Höfen der Bauern anboten. Sie trugen ihre Waren oft in großen Weidenkörben auf dem Rücken, den Kiepen, und wurden daher auch Kiepenkerle genannt. Einige Kiepenkerle entwickelten ganz eigene Sprachen, die oft nur in einem Ort oder in einer begrenzten Gegend gesprochen wurden.
Und mit Latein in Krämerlatein ist nicht etwa die Sprache der alten Römer gemeint, sondern allgemein eine fremde, unverständliche Sprache. Mit dem Wort Krämerlatein wurden also die Sondersprachen der fliegenden Händler bezeichnet.
Ein Beispiel für das Krämerlatein war der Henese Fleck (schöne Sprache). Die Geheimsprache wurde von den Kiepenträgern aus der niederrheinischen Gemeinde Breyell benutzt. Zahlreiche Begriffe der Sprache stammen aus dem Rotwelschen und dem Limburgischen. Durch ihre Geheimsprache konnten sie Informationen etwa über Preise unter sich behalten.
Mit der Erhöhung des Wohlstands in Deutschland und mit der Ausbreitung der Massenmedien wie Radio und Fernsehen seit den 1950er Jahren hat die Verbreitung der Geheimsprachen stark abgenommen. Das Hochdeutsche hat sich weitgehend durchgesetzt. Andererseits gibt es heute eine Geheimsprache bei den Jugendlichen und durch die Migration nach Deutschland werden zahlreiche ausländische Sprachen wie Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch, Polnisch, Albanisch und Farsi und weitere gesprochen, die für die Einheimischen auch Geheimsprachen sind. Als Geheimsprachen im weitesten Sinn muss man wahrscheinlich auch die deutschen Dialekte Berlinerisch, Kölsch, Plattdeutsch, Missingsch, Bayrisch etc. einstufen.
Und dazu kommen noch die vielen Touristen, zumindest in Berlin, die Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Skandinavisch und weitere Sprachen sprechen. Es gibt so viele Sprachen und Dialekte, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Insofern haben wir heute ein wahres Dorado für Sprachforscher.
Zum Anfang
2025/03/10
Wolfgang Weber
Krämer
Krämer sagt heute keiner, ein Begriff aus alten Zeiten
vielen nicht mehr bekannt bei weitem
Latein auch aus alten Zeiten.
ich hatte drei Sprachen in der Schule:
Englisch, Französisch, Latein, dazu natürlich Deutsch,
Plattdeutsch sowie Missingsch (das ist halb Hochdeutsch, halb Platt, in und um Hamburg)
beides nicht in der Schule
viel später Berlin(er)isch, fragt nicht wo
viele Sprachen
Krämer mancherorts
Geschäftemacher
organisiert in Gassen für
Schneider
Schuster
Bäcker
Juweliere
Barbiere
Salbader
Quacksalber
Maler
Antreiber
Bouquinisten
Musiker
finde die Fehler
behalte sie
sprachen all diese Gewerke Latein
damals im Mittelalter
ich weiß es nicht
war nicht dabei
wenn dann war es wohl
Küchenlatein
also nicht das Original
sondern eine mehr oder weniger stark veränderte Fassung davon
vergleichbar mit Sonderformen des Englischen
irgendwo im Commonwealth
wie etwa Pidgin English
von pigeon = Taube
Schreibung geprüft
bei mir um die Ecke ist
eine Schule mit Kunstprofil
die Karl Krämer Grundschule
mach Deinen Kram
do your own thing
früher zahlte man in
Taler
Mark
was auch immer
jedenfalls
in Münzen und Scheinen
davor mit Muscheln und Steinen
manche greifen inzwischen
zur Kryptowährung
aber nicht für'n Appel und 'n Ei
wie seriös solche Herrschaften sind
ich will's lieber nicht wissen
ob sich Kakteen küssen
oder hinter dem Rücken
der Andren dissen
also einander vermissen
sondern sich bewerfen
mit Erd-, Hasel- und Walnüssen
wer kann oder will das wissen
in Illertissen
oder Müssen
dort an den Flüssen
keine Tränen darüber vergossen
auch nicht in Zossen
Fische mit großen Flossen
nein
nicht in Zossen
niemals nicht
sie bewerfen sich immer noch mit Nüssen
eine vegetarische
womöglich vegane Form
von shit storm
das ist ganz enorm
wer macht denn so was
schmeißt denn da mit Lehm
Einhorn
Zweihorn
am Matterhorn
nicht so weit
von Langenhorn
Nordhorn
Hamburg Horn
Horner Rampe
Mampe halb und halb
goss sich früher manch einer
manch eine hinter die Lampe
hieß das so
sagt es mir
oder
Wampe
kann man sagen
das versteht kaum einer
Rudis Resterampe
gibt's wohl nicht mehr
sagt mir wo
Lampe ohne Leuchtmittel
oder Artikel ohne die
notwendige(n) Batterie(n)
finde ich seltsam
ich meine
solche Artikel sollten
eigentlich komplett verkauft werden
mit allem was dazu benötigt wird
was ich mal auslasse
sind Begriffe wie
Anglerlatein
Seemannslatein
Seglerlatein
ich habe heute schon genug übertrieben
vielleicht wissen
Andre dazu was zu sagen.
© Wolfgang Weber, März 2025.
Zum Anfang
2025/03/06
Sandra Wiedemann
Der Tornado
So unsäglich viele Gedanken
und keiner davon hält lange an.
Will mich für das Gute bedanken,
doch komme erst gar nicht gedanklich dort an.
Was hat sie gemeint, als sie das sagte?
Wann war noch gleich der Termin?
Weißt du noch damals, als dich dieser Verlust plagte?
Hat man mir den Fehler vorhin wirklich verziehen?
Ein Tornado, der jeden Gedanken frisst
und dann mit anderen durch die Lüfte wirbelt.
Auch wenn das absolut belastend ist,
weil sich Gedanke mit Gedanke verzwirbelt.
Und irgendwann spuckt er alles als Knäuel wieder aus
und du sortierst verzweifelt die falschen Enden aus,
in der Hoffnung, du ziehst zum Schluss den wichtigen Gedanken wieder heraus.
Wenn es gut läuft einmal die Woche,
manchmal mehrmals am Tag.
Egal ob ich entspanne, arbeite oder koche.
Der Tornado zieht auf, wann er es mag.
Ich kann mich nicht dagegen wehren.
Oft merke ich dessen Entstehen kaum.
Versuche sofort meinen Geist zu fokussieren und zu leeren,
doch er duldet keinen leeren Raum.
Alles muss einen Zweck haben,
alles muss funktionieren,
der Tornado will sich an den Zweifeln laben
und lässt sie dann wild kursieren.
Ich hinterfrage dich. Ich hinterfrage Emotionen.
Doch vor allem hinterfrage ich mich und die Gefühle, die in mir wohnen.
Genüge ich? Was kann ich besser machen?
Mag man mich? Weshalb mögen sie wirklich lachen?
Ich kann keinen klaren Gedanken fassen
und komme nirgends voran.
Die guten Dinge scheinen zu verblassen
und die schlechten stehen vorne an.
Jedes Thema findet seinen Platz,
egal wie klein, egal ob Trauer oder Liebe.
Doch leider beende ich nicht einen Satz,
weil ich dann den nächsten dazwischen schiebe.
So ist jeder Gedanke unbeendet
und jeder Zweifel bleibt ungelöst.
Die Zeitinvestition verschwendet,
was wiederum auf Zweifel stößt.
Dieser Kreislauf will einfach nicht enden
und raubt unerträglich viel Kraft.
Kann zwar die anderen doch nie mich selbst blenden.
Sacke zusammen, geknickt und geschafft.
Mich überfordern dann die kleinsten Dinge.
Denn die Energie ist im Tornado draufgegangen.
Weil ich nur von Zweifel zu Zweifel springe,
bin ich in meiner Unsicherheit gefangen.
Es heißt, nach der Ruhe kommt der Sturm.
Hier ist es genau andersherum.
Man baut aus Zweifeln einen Turm.
Ist er zu doll beladen, kippt er um.
Nach der Überforderung wird es plötzlich still.
Geist und Herz, einfach alles leer.
Völlig egal, wer was von mir will.
Denn ich denke gerade an gar nichts mehr.
Erst damit tritt langsam Entspannung ein
und ganz allmählich fangen im Nährboden aus den alten Zweifeln neue Gedanken an zu keimen.
Es entspringen neue Ideen
und wachsen zu Plänen heran.
Ich freue mich wieder, nach vorn zu sehen.
So fühlt sich für mich "Glücklich sein" an.
Jetzt sind die Fragen noch überschaubar
und es ist genügend Freiraum zur Entfaltung da,
mein Geist aufgeräumt und sauber.
Habe Visionen, die ich vorher nicht sah.
Aber es werden weiter neue Fragen entstehen,
bis der Platz abermals nicht reicht.
Man kann es jetzt schon kommen sehen.
Der Tornado hat's dann wieder leicht.
Wie Unkraut sprießen die neuen Gedanken
und ich kann sie einfach nicht stoppen.
Sie werden sich wieder ineinander ranken
und sich um ihre Prio kloppen.
Dann beginnt sich der Wust zu drehen
und so der nächste Tornado zu entstehen.
Er fegt dann erneut über alles hinweg.
Und damit beginnt es wieder von vorn.
Aber immerhin beseitigt er Altes und Dreck,
sorgt für frischen Wind und verteilt die Spor'n.
© Sandra Wiedemann, März 2025.
Zum Anfang
2025/03/02
Ein Besuch im Pergamon-360°-Panorama von Yadegar Asisi
von Dr. Christian G. Pätzold

Ausschnitt aus dem großen Pergamon-360°-Panorama von Yadegar Asisi.
Foto von Dr. Christian G. Pätzold, Januar 2025.
Das Pergamon-Museum in Berlin Mitte auf der Museumsinsel mit dem weltberühmten Pergamonaltar ist schon seit längerem geschlossen. Es wird auch noch einige Jahre geschlossen bleiben wegen der umfangreichen Sanierungsarbeiten an dem großen Gebäude, die sich hinziehen. Einige sprechen vom Jahr 2045 für die Wiedereröffnung des Pergamon Museums. Aber das ist eine Phantasiezahl, da niemand weiß, ob genügend Geld für die Sanierung zur Verfügung gestellt wird. Der Pergamonaltar ist zwar Weltkulturerbe, aber er wird der Welt wohl sehr lange vorenthalten werden, da das Geld für Anderes ausgegeben wird.
Als eine Art Ersatz für das geschlossene Pergamonmuseum wurde für die Besucher:innen vor ein paar Jahren gegenüber vom Museum am Kupfergraben 2 das Pergamon-360°-Panorama von Yadegar Asisi eröffnet, eine halb kommerzielle, halb wissenschaftliche Veranstaltung. In einem Rundbau, der Rotunde, ist das große Panorama-Bild mit den Maßen von etwa 100 Metern Breite und 23 Metern Höhe angebracht. Das Bild ist aus 34 bedruckten Bahnen zusammengesetzt. Ein so riesiges Monumentalbild von 100 Metern x 23 Metern bekommt man normalerweise nie zu sehen, und daher denkt man kaum, dass man vor einem Bild steht, sondern hat fast das Gefühl, man wäre in einer tatsächlichen Landschaft.
Yadegar Asisi ist ein deutscher Architekt und Künstler aus einer iranischen Familie, der 1955 geboren wurde. Seit 2003 kreierte er die größten Panoramen der Welt. In Berlin gibt es ein weiteres Panorama von ihm, das Panoramabild "Die Mauer", das seit 2012 in einer Rotunde am Checkpoint Charlie gezeigt wird. Dargestellt ist die Berliner Mauer an einem Novembertag in den 1980er Jahren in Berlin Kreuzberg. Gegenwärtig hat Yadegar Asisi auch Panoramen in weiteren Städten aufgebaut, so in Dresden, Leipzig, Wittenberg und Pforzheim, die man als kommerzielle-wissenschaftliche-historische-künstlerische Mischungen ansehen kann.
Große Panoramen waren bereits im 19. Jahrhundert eine publikumswirksame Attraktion, denn man konnte sich an einem anderen Ort fühlen, ohne die Mühen der Reise auf sich zu nehmen. Als ihr Erfinder gilt der irische Maler Robert Barker, der 1806 starb. Die Panoramen waren damals noch ganz traditionell von Malern mit dem Pinsel gemalt. So war es auch bei dem großen Bauernkriegspanorama in Frankenhausen in der DDR. Es wurde in den Jahren 1976 bis 1987 von dem Maler Werner Tübke (1929-2004) und Kollegen auf Leinwand gemalt. Es war eine riesige Arbeit, jede Figur und jede Szene wurde von Hand gemalt. Das Bauernkriegspanorama in Frankenhausen hat mit 123 Metern Länge und 14 Metern Höhe ähnliche Ausmaße wie das Pergamon-Panorama.
Das Pergamon-Panorama ist dagegen hauptsächlich mit digitaler Fototechnik hergestellt worden. In Fotoshootings mit Schauspielern und Statisten in antiken griechischen Kostümen wurden die Szenen des Panoramas aufgenommen. Die digital bearbeiteten Bilder wurden dann in das Landschafts- und Architekturpanorama eingefügt und auf Kunststoffbahnen gedruckt. Da es sich um echte Menschen handelt, die dargestellt werden, ist die Wirkung besonders realistisch.
Das Panoramabild in der Rotunde soll die Situation in Pergamon am 8. April des Jahres 129 uZ zeigen, als der römische Kaiser Hadrian (76-138) die Stadt besuchte, anlässlich des ersten Tages des Festes der Dionysien, das 4 Tage dauerte. In der Architektur der Stadt Pergamon ist daher viel los, viele Menschen sind zu sehen, die an dem Fest teilnehmen. Dionysos war der antike griechische Gott des Weins, der Vergnügungen, des Rauschs und der Ekstase und des Theaters. Entsprechend waren die Dionysien eine Art antiker Straßenkarneval. Der Pergamonaltar selbst war Zeus gewidmet, man sieht Tieropfer im Panorama.
Die Stadt Pergamon, das heutige Bergama (mit etwa 70.000 Einwohnern), liegt nahe der Westküste Kleinasiens in der heutigen Türkei, etwa 80 Kilometer nördlich von Smyrna, dem heutigen Izmir. Pergamon gehörte damals zum Imperium Romanum und war eine bedeutende griechische Stadt. Nach Pergamon ist übrigens das Pergament benannt, das sind Tierhäute, die früher als Schreibunterlage dienten, bevor sie vom Papier abgelöst wurden.
Mich hat besonders der 3D-Effekt des Panoramabildes interessiert. Die Besucher:innen des Panoramas befinden sich in der Mitte der Rotunde auf der Plattform eines hohen Gerüstes und haben einen Blick quasi aus der Vogelperspektive in alle Himmelsrichtungen. Es ist erstaunlich, dass ein Eindruck der Weite der mediterranen Landschaft und des Lebens in der Stadt anlässlich des Festes entsteht.
Die Maße von 100 Metern Kreisumfang x 23 Metern Höhe für das Panorama scheinen sehr sinnvoll zu sein. Erstens sind 100 Meter eine schöne runde Zahl und sie erlauben auch einen 3D-Effekt. Daraus ergibt sich ein Radius von 16 Metern, das heißt die Besucher:innen sind etwa 15 Meter vom Bild entfernt und haben so einen Panorama-Eindruck. Die Höhe von 23 Metern entspricht der Berliner Traufhöhe, über 99 Prozent der Gebäude in Berlin haben diese Maximalhöhe oder tiefer. Dadurch ergeben sich keine Probleme mit den städtischen Genehmigungsbehörden und außerdem sind die Berliner Besucher an diese Höhe in ihrem Blick gewöhnt. Zusätzlich spielen die Lichteffekte und die Soundeffekte im Panorama auch große Rollen.
Die zusätzliche informative Ausstellung in der Vorhalle zum Panoramabild ist auch sehr sehenswert. Dort trifft man unter anderem auf originale antike Marmorstatuen aus Pergamon. Außerdem gibt es noch einen kleinen Museumsshop mit Büchern und Souvenirs und eine Cafeteria. In der Zukunft soll an Stelle des Pergamon-Panoramas ein Panorama des antiken Babylon gezeigt werden.

Foto von Dr. Christian G. Pätzold, Januar 2025.

Am Kupfergraben 2, Berlin Mitte.
Foto von Dr. Christian G. Pätzold, Januar 2025.
Zum Anfang
2025/02/28
Zum Anfang
2025/02/25
Ingo Cesaro
HAND AUFS HERZ
schiebt das Leinentuch zur Seite
weint und kämpft mit den Tränen
versucht seinem toten Sohn
Kekse in die kleine Hand zu legen
was nicht gelingt
legt sie schließlich daneben
die mochte er gerne
flüstert der Mann im Abschiedsschmerz
und deckt den toten Sohn wieder zu
uns stehen Tränen in den Augen
trauern mit dem Vater
drücken die Tränen nicht weg
und Hand aufs Herz
trauern wir auch noch
wenn wir erfahren
es ist ein palästinensischer Junge
und alles passierte
im heftig umkämpften Gaza-Streifen.
© Ingo Cesaro, Februar 2025.
www.ingo-cesaro.de
Zum Anfang
2025/02/21
Dagmar Sinn
Februar
Februar, neues Jahr
hält er, was er verspricht?
Längere Tage, Weg zum Frühling,
mit ihm Sonne, Licht?
Februar, wie er mal war
Kälte, Schnee und Wind
Schlittenfahrt als Kind,
Schlittschuhtreffpunkt war der Teich,
hartes Eis, nie fiel man weich
Februar in diesem Jahr
gibt uns Rätsel auf.
Klimawandel spürt man nah,
wie wird sein Verlauf?
Schneeglöckchen und Krokus blühn,
klein und scheu im Garten stehn.
Ganz genau wie letztes Jahr,
jetzt ist wieder Februar.
Der erste Schnee
Heut morgen bin ich aufgewacht
und schau in eine weiße Pracht.
Der erste Schnee in diesem Jahr!
Wie friedlich liegt die Welt jetzt da
Pudrig weiß, so deckt der Schnee
alles zu wohin ich seh.
Weckt in mir den Kindheitstraum:
Schlitten raus und Schneemann baun!
© Dagmar Sinn, Februar 2025.
Zum Anfang
2025/02/17
Renate Straetling
Winter Haiku und Tanka
Wattiertes Draußen
erbaulich still ist es -
der neue Wintertag
Geäst krallt durchs Eis
See verschmilzt mit Nebelband
Agonie in Grau
Pfeilgrad fliegend
zwei Linien Morgenrot
wolkenfreies Blau
Klänge wie im Off
Der Neuschnee lockt ins Freie
Mein Herz frisch und klar
Wege liniengenau
Äcker, Wiesen, Berge starr
Eisschollen kämpfen
Gleißen und Funkeln
Eiswind rauscht unerbittlich
Jeder Baum feiert
Morgenschnee, harschig
auf den Tischen beim Imbiss
Smileys vom Schulweg
Keine Krippen mehr,
Engel und Christkind perdü -
nur Zweige blinken
Zwischen den Jahren
sorgenfreies Vakuum,
Träume nachfüllen
An Silvester, parterre
Duft frischer Frühlingssuppe
ein letztes Sparmenü
Leises Getrappel
noch krawummen Raketen
Getuschel im Hausflur
Dutzende Füße gehen -
vier kommen feierlich heim
Neujahrscrescendo
verebbt in Donnerschlägen
einzelne Pengs noch -
... ein erstes Aufhorchen
in exzentrischer Ruhe
Februarwärme
und Eisblumen am KuDamm
dicke Sonnenbrillen
Kurze Tage noch
kräftiger das Licht wieder,
Ansporn bis Valentinstag
© Renate Straetling, Februar 2025.
Buchempfehlung:
Der Link zum Sammelband III von Renate Straetling von Oktober 2024 ist:
https://www.epubli.com/shop/sammelband-iii-meine-haiku-2013-2024-9783759898234
Dort gibt es auch ein paar Vorschauseiten, z.B. das Inhaltsverzeichnis.
"Ein weiterer Haiku-Sammelband, der dritte! Es handelt sich um die erweiterte Ausgabe vom Januar 2022. Im vorliegenden Band sind meine gesammelten fast 400 Haiku, Tanka, Honka dori und Haibun zu verschiedenen Themen gesammelt und gruppiert, zudem mit 23 SW-Abbildungen illustriert. Das Haiku als besonderes kurzlyrisches Gedicht mit seinen 5-7-5 Silben in drei Versen und seinem Naturbezug im Konkreten und Authentischen bietet, der japanischen Tradition entlehnt, die kommunikative Gelegenheit, Momente zu formulieren, die in bis zu 17 Silben und in einem Atemzug darstellbar sind. Ich stelle in diesem Sammelband vor allem meine "In der City"-Haiku, sozusagen gewachsen auf Beton und gesehen durch eine lebenserfahrene Brille, vor; ebenso Haiku zur Coronazeit und neun Haibun (Reiseerlebnisse mit Haiku) vor, die damit meine zwölf bisherigen Haiku-Bändchen großenteils zusammenfassen. Die Länge eines Atemzugs für einen verbindenden Gedanken, für einen authentischen Moment!"
Zum Anfang
2025/02/14
www.kuhlewampe.net gibt es seit 10 Jahren !
10 Jahre künstlerische Sinntelligenz
Vielen Dank an die vielen Mitwirkenden in all den Jahren !
Na klar machen wir weiter, trotz alledem
Zum Anfang
2025/02/10
Reinhild Paarmann
Laienschauspieler in Berlin
Eine Laienschauspielgruppe aus Bielefeld hat eine Woche Fortbildung in Berlin gebucht. Am ersten Abend will sie zum Berliner Ensemble und die "Drei Groschenoper" von Brecht sehen. Anja hat eine sehr schöne Stimme, sie traut sich zu, die Polly zu singen, wenn sie das Stück bei sich zu Hause aufführen würden.
Sie kommen an. An der Tür hängt ein Schild: "Wir spielen erst wieder, wenn wir durch das Verlosen von Schlafplätzen auf unserer Bühne genügend Geld zusammen haben. Der Berliner Kultursenator hat uns viel Geld gestrichen!"
Die Laienschauspieler*innen sind enttäuscht. Ihre Leiterin meint: "Macht nichts, es gibt so viele Theater in Berlin. Versuchen wir es morgen woanders!"
Am zweiten Tag fahren sie zur Volksbühne, "ja nichts ist ok" steht auf dem Programm. An der Tür ein Zettel: "Zwei Millionen Budgetkürzung für 2025 für uns, so können wir nicht mehr spielen!"
Die Laienschauspieler sind frustriert. Was nun? Die Theaterleiterin schlägt vor, am nächsten Tag zur Tanz-Compagnie Sasha Waltz zu fahren. "Twenty to eight" wollen sie sich ansehen.
An der Eingangstür hängen vier Sätze: "Sie wollen ein Tanztheater sehen?
Bei den Kürzungen von 200.000 € geht das nicht.
Melden Sie sich zu einem Workshop bei uns an. Wir tanzen erst wieder auf der Bühne, wenn wir genügend Geld zusammen haben."
"Berlin Kulturhauptstadt?" mault Anja, "dass ich nicht lache!"
"Morgen versuchen wir es bei der Schaubühne!", die Leiterin der Gruppe lässt sich nicht so schnell entmutigen. Tatsächlich finden sie eine offene Tür. Auf der Bühne radeln zwei Schauspieler auf einem Stand-Rad. "Wir produzieren so unseren eigenen Strom", steht auf einem Pappkarton. "15 % der Subventionen wurden uns gestrichen. Wir können den Strom nicht mehr bezahlen." Die Schauspieler spielen das Stück: "Glaube, Geld, Krieg und Liebe". Wer glaubt an das Geld, das die Theater nicht mehr so bekommen, der Krieg in der Ukraine muss bezahlt werden, die Liebe zum Theater steht zurück. Es geht im Stück um den Ukraine-Krieg und die Leihmütter. Leihen wir uns doch Geld, aber die Schuldenbremse erlaubt das nicht. Die Aufführung ist einfach großartig. Aber fünf Stunden? Anja ruckelt unruhig auf ihrem Po. Zum Glück gibt es eine Pause.
"Morgen fahren wir zum Hau-Theater!", verkündet die Theaterleiterin. Sie spielen "Wem gehört die Welt". Ja, wem gehört sie? Auf der Bühne stehen Tai Chi Meister, die sich nach ihren Übungen an den Händen fassen, der letzte hält eine Glühbirne, die nun aufleuchtet durch die Tai Chi Energie.
"Buchen Sie bei uns einen Tai Chi-Kurs, um selbst Strom herstellen zu können. Wir haben nur noch zwei Stellen à 16 Stunden bewilligt bekommen. Wir können erst wieder spielen, wenn wir genügend Geld zusammen haben!"
"Wir wollen Theater sehen!", skandieren die Laienschauspieler*innen im Bus.
"Morgen besuchen wir das Gefängnistheater!", sagt die Leiterin der Gruppe.
"Die spielen "1984" von Orwell."
Als sie dort ankommen, ertönt eine Stimme aus einem Lautsprecher: "Hier spricht der Wohltäter. Theater wird ab heute gestrichen. Wir geben kein Geld aus für solchen Firlefanz!"
Die Berlin-Besucher haben die Nase voll. "Wir wollen nach Hause!", rufen sie. "Bei uns ist ja mehr los als in Berlin!" Ja: "Berlin ohne Kultur ist nur Bielefeld mit big buildings." (Barrie Kosky, Ex-Intendant der Komischen Oper)
© Reinhild Paarmann, Februar 2025.
Zum Anfang
2025/02/06
Zum 70. Geburtstag von Jeff Koons
geboren in York/Pennsylvania/USA am 21. Januar 1955

Eine 12 Meter hohe Hand hält 11 Tulpen.
Erinnerung an die Anschlagsopfer von 2015 in Paris, Charlie Hebdo Januar 2015,
und Bataclan-Theater November 2015.
Bronze, Stahl, Aluminium.
Foto von 2019. Urheber: Bybbisch94. Quelle: Wikimedia Commons.
Zum Anfang
2025/02/02
Wolfgang Weber
Schrei nach Lyrik
changieren
chargieren
anti-chambrieren
never change a winning team
knatter
chargen
knister
chargen
chiffon changiert
knisternd zwischen
zartbitter & bittersüß
chambre de commerce
chambre de chiffon
schrei nach liebe
edvard munch
der schrei
in verschiedenen variationen
archie shepp
the cry of my people
der schrei nach
après
after
je nachdem
liebe
dance me to the end of love
dance me to the end of the chiffons round your shoulder
tanzen bis sich der chiffon auflöst
bitter & süß
tanzen wir
bis die chiffoniere
der kleiderschrank
leer ist
liebe wie
symbole
allegorien
sinnbilder
icons
schrei nach lyrik
gedicht
aphorismus
metrik
strophe
vers
sonett
so nett
schrei nach lyrik
L
lysistrata
liebesentzug gegen krieg
Y
yggdrasil
weltesche
steht für gesamten kosmos
R
rühmkorf peter
wer lyrik schreibt ist verrückt
I
Innen nach außen nach innen
K
kladde
kommentar
konkret
chiffon
durchsichtig
stoff
gedreht
gewendet
aus seide
kunst natur kunst
changierend
wie ein tuch
aus chiffon 50 x 50 cm
chiffon
tanz der sieben schleier
salomé
chiffon
in der luft
chiffon
am boden
chiffon
leicht
romantisch
verführerisch
sanft
dünn
transparent
elegant
love is in the air
chiffon
edel
luxuriös
kleider
blusen
dessous
schals
alles aus chiffon
chiffon
chiffre für
geheimnis
romanze
femininité
herausforderung
chiffon
bouillon
bitter & süß
süß & sauer
heiß & kalt
scharf & mild
heiß & kalt
bouillon
bouillon für napoléon
napoléon bonaparte
bouillon de la corse
bouillon for a horse
of course
changieren zwischen
unentschieden
unentschlossen
irgendwo dazwischen
wischi waschi
nolens volens
halb sank er
halb fiel sie
in ohnmacht
bitter
zartbitter
beigeschmack minze
after seven plus one
after eight
bin so wild
nach deinem erdbeermund
klaus kinski sprach auch
francois villon
changierend
zwischen
süß bitter zart
pralinés & schokoladen
gewickelt in chiffon
dazu ein chanson
von der leidenschaft
die leiden schafft
pralinés in chiffon
geworfen in die luft
aufgefangen zwischen momenten
des ein & ausatmens
& nicht atmens & atem anhaltens
chiffon
so betörend erotisch
faszinierend animalisch
zwischen
bitter süß zart
© Wolfgang Weber, Februar 2025.
Zum Anfang
2025/01/31
Zum Anfang
2025/01/30
Wolfgang Endler
Aus der Rubrik Bericht zur Schräg_Lage der Nazi_on
Ja_nu_ar_isch
Die Kerzen verraucht,
der Süßkram erbrochen.
Dezember verbraucht,
Vorsätze gebrochen.
Kurzschluss in Ampel,
ausgelutschte Träume.
In den Staaten GeTRUMPel,
Waldbrand frisst Mammutbäume.
Rente für Merkel-Mutti.
Voll im Trend Alice & Sahra.
Remigriern? Alles tutti!
Freie Fahrt für Geisterfahrer!***
Lob für Brunnenvergifter:
lokal, national und global.
Drohnen auf Friedensstifter,
Menschenrecht voll egal.
***selbstverständlich m, w, div /
unabhängig von sexueller Orientierung!
© Dr. Wolfgang Endler, Januar 2025.
Wolfgang Endler
Kontra(st)programm-Kommentar
Null Bock auf weltweite Klimakiller,
Aktien statt Klimaverträge schreddern.
Selbstbestimmt Menschenpflicht erfüllen,
Peace Songs statt Nazi-Hymnen schmettern.
voll solidarisch statt doofdeutscharisch.
© Dr. Wolfgang Endler, Januar 2025.
Zum Anfang
2025/01/26
Manuel Wanser
Cathis Tagebuch
Montag
11.00 Uhr
Heute Casting. Freu mich drauf, voll! Alle wissen ich bin gut. Mein Sprungbrett!
12.30 Uhr
Die sagten, ich sollte mir nochmal überlegen am Gesang festzuhalten. Keine Ahnung haben die!
Sitzen da und wissen alles besser, oder was? Idioten!
14.00 Uhr
Vor Frust ne Runde geschlafen. Bin ich zu weit? Nicht mehr formbar? Wieso nehmen die mich nicht? Ihr Pech.
14.20 Uhr
Muss mehr Promo machen. Noch zu wenig Hörer auf Spotify.
16.00 Uhr
Lars sagt, dass er neue Fotos für Insta mit mir macht. Am Wochenende. Zweihundert die Stunde.
Ich ruf Papa an. Er ist mein größter Förderer.
18.00 Uhr
Treff mich gleich mit Mareike. Sektempfang, Vernissage. Berlin ist einfach so geil. Nie wieder Provinz!!
23.20 Uhr
Hab jemanden kennengelernt. Macht auch Musik und hat ein Studio in Marzahn. Sven. Der Name ist nicht so schön, er aber schon, irgendwie. Er sucht einen weiblichen Gesangspart. Ich soll morgen mal vorbeikommen.
Dienstag
10.30 Uhr
Elf monatliche Hörer. Spotify ist nicht die richtige Plattform. Ich brauche Leute, die Musik auch richtig fühlen können.
12.00 Uhr
Treffe mich zum Brunch mit Anna. Berlin ist so nice!
13.30 Uhr
Anna macht am Mittwoch eine Performance in der Amerika Gedenk. Demokratie stärken ist das Thema. Leute vom Fernsehen kommen auch. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich da bestimmt auch singen können.
17.00 Uhr
Me Time gehabt. Felix Neumanns Buch "Fühle dich - Dann fühlt dich die Welt" ist mein persönlicher Erweckungsmoment 2024. Werde auf jeden Fall auch die Online Seminare machen.
19.00 Uhr
Papa ist so lieb, er unterstützt die Idee mit den Seminaren total. Er bezahlt das für mich. Ich hab ihm gesagt, dass ich mich voll fokussieren muss. Da kann ich jetzt nicht auch noch nen Job annehmen.
21.00 Uhr
Hab mit dem süßen Typ von der Vernissage geschrieben. Er veröffentlicht über Soundcloud. Da sind definitiv auch Leute die Musik zu schätzen wissen. Er macht Rap und sucht einen Gesangspart. Das passt doch perfekt! Ich mag Hip Hop auch, total!
22.10 Uhr
Gott, ich brüte schon wieder was aus. Der Stress tut mir nicht gut! Mein Hals fühlt sich komisch an. Trinke seit einer Stunde Matcha Tee. Wenn das so bleibt, kann ich morgen nicht zu Anna.
Mittwoch
10.00 Uhr
Papa hat überwiesen. Er ist einfach so lieb! Ich glaub ich feier Weihnachten in München. Hab aber gar keinen Bock auf Melanie und ihre Kinder. Sie ist soooo feindselig mir gegenüber! Ich kann doch nichts dafür, wenn sie ihre Träume für ein Spießerleben wegwirft. Ich glaube sie wäre gerne so frei wie ich. Sie ist definitiv neidisch!
12.00 Uhr
Anna war etwas enttäuscht über meine Absage, was ist los mit ihr?? Meine Stimme ist mein Kapital. Sie sollte echt mal reflektierter sein.
13.00 Uhr
Hab mir Sushi Frühstück gegönnt, habs auch gepostet. Viele Likes. Muss echt mehr Insta machen.
14.30 Uhr
Heute kommt der Ablesedienst, hab keine Zeit dafür. Können die das nicht digital machen??
Richtig rückständig. Das nervt!
16.10 Uhr
Sven hat angerufen. Ich hab ihm aber erstmal abgesagt fürs Wochenende. Meine Stimme ist noch nicht bei hundert Prozent. Holen wir aber nach. Ich hab ein gutes Gefühl dabei. Rap ist auch definitiv angesagt!
18.00 Uhr
Der Typ vom Rewe Bestelldienst war mega unfreundlich. Motzt rum, weil es keinen Fahrstuhl gibt. Ist doch eure Arbeit Leute!!
18.10 Uhr
Hab einen Termin bei Dr. Wimmer gemacht. Kann gleich morgen kommen. Mein Hals fühlt sich nicht gut an.
19.00 Uhr
Melanie hat mir geschrieben. Sie findet es nicht OK von mir, Papa finanziell auszunutzen. Was soll der Scheiß! Sie denkt immer noch, sie sei was besseres. Will mich zum schwarzen Schaf der Familie machen. Sie weiß gar nicht, wie sich das für mich anfühlt. Talentfreie Kuh!
20.15 Uhr
Bettina hat mich auf einen Wein eingeladen. Beste Nachbarin überhaupt! Ihr Mann bleibt doch bei der neuen. So ein Arschloch!
Donnerstag
09.50 Uhr
Ich weiß nicht! Gestern hab ich diese Doku über Basquiat bei Netflix gesehen. Das soll Kunst sein?? Kann ich auch!
10.50 Uhr
Papa hat mich gefragt, ob er mich besuchen kann am Wochenende. Was soll diese Überwachung?? Das ist bestimmt auf Melanies Mist gewachsen. Hab ihm gesagt, dass es mir gesundheitlich gerade nicht passt. Ist ja nicht mal gelogen.
11.25 Uhr
Dr. Wimmer meint, ich soll meine Stimme erstmal schonen. Er hat eine leichte Rötung gesehen und kann nicht ausschließen, dass es schlimmer wird. Na toll. Wieder gebremst!
12.30 Uhr
War auf dem Wochenmarkt. Die haben so gute Sachen da! Echtes Bio, nicht das gefakte! Hab mir Gedanken wegen meiner Stimme gemacht. Deshalb heute nur Ingwer Tee und Netflix.
18.00 Uhr
Hab kurz mit Sven geschrieben. Er hat den Gesangspart jetzt mit einer anderen gemacht. Das wird sowieso nichts. Marzahn klingt eh strange. Hatte von Anfang an kein gutes Gefühl dabei.
19.30 Uhr
Anna hat mir geschrieben und meinte, dass die Fernsehleute sie am Mittwoch gefragt haben, ob sie einen Clip für Arte zusammen machen wollen. Arte ist schon gut, aber ein Clip ist ja auch echt kurz.
20.00 Uhr
Bin richtig müde vom Lavendel-Minze Bad. Hab Essen bestellt. Thai. Geht auf jeden Fall nicht für Insta. Viel zu lieblos arrangiert. Schmeckt noch okay. Morgen ist Freitag. Ich hab noch keine Pläne gemacht. Bin psychisch auch grad nicht so social.
Freitag
10.11 Uhr
Hab heute echt Bock auf feiern! Hab Jette angeschrieben. Hab gesehen, dass sie in Berlin ist. Irgendeine Tierschutz Konferenz. Mit ihr hatte ich definitiv die coolsten Party Nächte!
11.24 Uhr
Jette ist leider mit ihrem Freund in Berlin. Sie hätten Lust was zu machen. Hab abgesagt, der Typ nervt einfach. Hat mich mal angeschrieben. Habs Jette nie erzählt. Kein Bock auf schlechte Vibes.
13.01 Uhr
War spazieren. PrenzlBerg hat ja soo schöne kleine Läden! Hab mir ne neue Kette gekauft. Gold steht mir. Mein Post hat 833 Likes. Kette überm Dekolleté. Onlyfans hatte ich auch schon mal auf dem Schirm.
13.23 Uhr
Papa ist da. Er hat mich überrascht. Er schläft im Radisson, damit er mich nicht belastet wegen meiner Halsentzündung. Er ist so lieb. Wir gehen mittags ins Borchardts.
15.06 Uhr
Papa sagt, dass Melanie meint, ich bin verwöhnt. Ich hab ihm erklärt, dass sie einfach keine Vision hat! Er meint, ich müsste mir langsam etwas mehr Gedanken machen, weil ich auch bald Dreißig werde. Ich musste ihm schon wieder erklären, dass es ja nicht an mir liegt.
16.28 Uhr
Papa hat mich zum Shoppen auf den Kudamm entführt. Die Taxifahrt war leider richtig lang und die Klimaanlage hat meinem Hals den Rest gegeben. Ich hab aber auf die Zähne gebissen und wir waren 2 Stunden nur Klamotten kaufen.
18.33 Uhr
Ich hab Papa gesagt, dass ich jetzt etwas Zeit für mich brauche. Ich sehe ihn morgen wieder.
19.27 Uhr
Meine Outfit Posts kommen richtig gut an. Besonders die knappen Teile haben richtig viele Likes. Ich weiß auch einfach, wie man posiert. Melanie hat kommentiert, dass ich billig aussehe. Hab sie geblockt. Hat die viel Hate in sich!
20.45 Uhr
Lasse hat mir ne DM geschickt. Er wohnt jetzt auch in Berlin. Wir gehen später ins Soho House. Record Release Party von irgendsonem DJ. Es sind viel Leute aus der Musik Branche da. Yeah!
© Manuel Wanser, Januar 2025.
Zum Anfang
2025/01/22
Den Gordischen Knoten lösen
von Dr. Christian G. Pätzold
In der Geschichte der Menschen gab es einige spannende Rätsel, die gelöst werden sollten. Einige von ihnen konnten gelöst werden, andere nicht. Bekannt sind bspw. die mathematischen Rätsel, über die sich schon Generationen von Mathematikern vergeblich die Köpfe zerbrochen haben. Oder die Entzifferung der altägyptischen Hieroglyphen, die schließlich mit Hilfe des dreisprachigen Steins von Rosetta gelang. Oder die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, an der intensiv gearbeitet wird. Oder das Ei des Kolumbus. Und: Warum ist die Banane krumm?
Ein bekanntes Rätsel, das schon über 2.000 Jahre alt ist, ist die Lösung des Gordischen Knotens. Die Geschichte des Gordischen Knotens ist aus der Antike bei Plutarch und bei Quintus Curtius Rufus überliefert. Danach bestand der Gordische Knoten aus kunstvoll verknoteten Seilen am Streitwagen des phrygischen Königs Gordios, die die Deichsel des Wagens mit dem Zugjoch verbanden. Der Gordische Knoten soll aus dem Bast der Kornelkirsche geflochten worden sein. König Gordios soll übrigens auch der Vater des berühmten Königs Midas gewesen sein.
Nach einem Orakel sollte derjenige Herrscher über Kleinasien werden, der den Gordischen Knoten lösen konnte. Viele Männer sollen es versucht haben, aber keinem war es gelungen. Erst als Alexander der Große (356 vuZ - 323 vuZ), der König von Makedonien, im Frühjahr des denkwürdigen Jahres 333 vor unserer Zeitrechnung (3-3-3, bei Issos Keilerei, haben wir im Geschichtsunterricht gelernt) auf seinem Zug Richtung Persien nach Gordion, der von König Gordios gegründeten Stadt in Anatolien, kam, soll ihm die Lösung des Gordischen Knotens gelungen sein, indem er einfach sein Schwert zückte und den Gordischen Knoten damit durchschlug. Die Prophezeiung wurde wahr und Alexander wurde Herrscher über ganz Kleinasien.
Aber damit gab sich Alexander nicht zufrieden. Das griechische Heer Alexanders gelangte noch weiter nach Osten, bis nach Taxila in Pakistan. Dort waren die griechischen Soldaten schon so dezimiert und wahrscheinlich hatten sie auch Heimweh nach Griechenland, so dass sie den Rückzug antraten. Alexander der Große eroberte nicht nur Kleinasien, das Gebiet der heutigen Türkei, sondern später auch noch Ägypten, wo er als Pharao angesehen wurde und die Stadt Alexandria am Mittelmeer gründete. In seiner Jugend war Alexander in der makedonischen Hauptstadt Pella ein Schüler des griechischen Philosophen Aristoteles gewesen. Mit Alexander begann die antike Epoche des Hellenismus.
Jedenfalls ist die Redewendung vom Durchschlagen des Gordischen Knotens noch heute bekannt, wenn von der Lösung eines schwierigen Problems mit unkonventionellen Mitteln gesprochen wird. Andererseits, wenn Alexander nicht da gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht heute noch ein hübsches Rätsel, an dem Knotenexperten herumbasteln könnten. Insgesamt betrachtet war Alexander ein jugendlicher Militarist und Imperialist, der ein großes Imperium begründete, das aber bald unterging, genau so wie das spätere Römische Imperium.
Zum Anfang
2025/01/18
Dagmar Sinn
Bilder aus der Lüneburger Heide

Foto von © Dagmar Sinn, 27.9.2024.

Der Name stammt wahrscheinlich von dem unfruchtbaren Boden.
Foto von © Dagmar Sinn, 27.9.2024.

Foto von © Dagmar Sinn, 27.9.2024.
Zum Anfang
2025/01/14
Wolfgang Webers Lesebühnen in Berlin
Zum Anfang
2025/01/12
Rio Reiser zum 75.
West-Berlin 9. Januar 1950 - Fresenhagen/Nordfriesland 20. August 1996

Zum Anfang
2025/01/10
Tagebuch 1974, Teil 79: Luang Prabang (Laos)
von Dr. Christian G. Pätzold

20. Januar 1974, Kasi - Luang Prabang, Sonntag
Morgens hat uns ein Laster nach Luang Prabang mitgenommen, der Decken auf der offenen Ladefläche geladen hatte. Wir waren zusammen 8 Ausländer und 2 Laoten oben auf der Ladefläche und wurden völlig zugestaubt, da die Straße nicht asphaltiert war. Gleich nach Kasi fängt das malerische Gebirge an, das sehr hoch und bewaldet ist. Die Straße führt an Berghängen entlang, die Vegetation ist tropisch.
Dass wir Reisende auf der offenen Ladefläche des Lasters untergebracht waren, war kein Problem bei dem schönen Wetter. Der Laster fuhr ziemlich langsam über die verschlungenen Bergstraßen. Das war auch nötig, denn wenn er schnell gefahren wäre, wäre er vielleicht einen Abhang in die Tiefe gestürzt, und das wäre es dann mit uns gewesen.
Zwischen Vientiane und Luang Prabang gab es an die 30 Schlagbäume und Straßensperren der laotischen Regierungstruppen. Die Regierungstruppen waren an ihren roten Fahnen mit 3 weißen Elefanten zu erkennen. Es gab unterwegs auch verschanzte Regierungsstützpunkte, an einem Stützpunkt gab es sogar einen Hubschrauber und Kanonen. Alle Leute liefen auf der Straße mit Gewehren herum.
Unterwegs kamen wir an etwa 20 Dörfern der Hill Tribes vorbei, die Tribe Peoples trugen traditionelle Kleidung. Es war viel Viehhaltung zu sehen, Schweine, Kühe und Wasserbüffel. Wir kamen auch an 2 Opiumfeldern vorbei. Wir waren ja hier im berühmten Golden Triangle des Opiumanbaus, wo der Schlafmohn so gut wächst.
In Luang Prabang angekommen haben wir 1.500 Kip (5 DM) pro Person für die Fahrt mit dem Laster bezahlt. Wir sind in der Royal Travellers Lodge abgestiegen, die einem Inder gehörte. Die Übernachtung kostete nur 500 Kip (weniger als 2 DM) pro Person, obwohl die Absteige "Königliche Reisende Herberge" hieß.
Einige Preise: Milchkaffee 50 Kip (etwa 15 Pfennige), Kola 70 bis 100 Kip, Kleines Weißbrot 30 bis 50 Kip, Nudelsuppe 100 bis 200 Kip (weniger als 1 DM), Reis mit Gemüse 300 Kip (1 DM), Zigaretten waren billig: 20 Stück für 80 Kip (25 Pfennig).
21. Januar 1974, Luang Prabang, Montag
In Luang Prabang waren wir im Informationsamt der Regierung, wo wir einen Propagandafilm gegen die Kommunisten gesehen haben. Die Story handelte von einem Regierungsarzt, dem die Medikamente von einer lokalen Dorfbande gestohlen wurden, die sie an die Nao Lao Hak Sat verkauften. Ein anwesender älterer Mann erklärte uns, dass das die Viet Minh wäre und als ich fragte: Pathet Lao ?, antwortete er: "That's all the same." Ich vermutete, dass der Film von der CIA finanziert worden war. Es gab hier auch eine "Lao-American Association", in der Fotos über das schöne Amerika ausgestellt waren und eine Bibliothek vorhanden war.
Anschließend haben wir ein paar der zahlreichen beeindruckenden Wats besucht, darunter die große Tempelanlage Wat Xieng Thong am Mekong.
22. Januar 1974, Luang Prabang, Dienstag
Morgens sind wir zum Mekong gegangen und haben zusammen mit einem englischen Zahnarzt und seiner Frau ein Motorboot gemietet, für 4.500 Kip (15 DM). Wir wollten zu den berühmten Pak Ou Caves fahren, die etwa 25 Kilometer nördlich von Luang Prabang am Mekong liegen. Es handelt sich um 2 Kalksteinhöhlen, die nur mit dem Boot über den Mekong erreichbar sind. Die Höhlen liegen an der Mündung des Flusses Nam Ou in den Mekong. Sie sind ein buddhistischer Wallfahrtsort mit hunderten von Buddhastatuen, vor allem aus Holz, die als Opfergaben von Pilgern aufgestellt wurden. Die Buddhas sollten wahrscheinlich die Wünsche der Pilger erfüllen.
Für die Hinfahrt zu den Höhlen stromaufwärts brauchte unser Boot 3 ½ Stunden, für die Rückfahrt mit der Strömung des Mekong nur 1 ½ Stunden. Wo der Nam Ou in den Mekong fließt sei der letzte Regierungsposten, danach käme das von der Pathet Lao beherrschte Gebiet, sagte unser Schiffer etwas ängstlich. Unterwegs haben wir eine Mekong Brauerei am Strand gesehen, wo aus Reis Alkohol gebraut wurde. Es waren auch Soldaten mit der Regierungsfahne am Strand zu sehen. Die Fahrt auf dem Mekong war schön, denn die Landschaft mit den Bergen ist malerisch und tropisch, obwohl der Motor des Bootes etwas zu laut war.
Abends haben wir in einem Restaurant in Luang Prabang französisch gegessen, an der Stelle, an der der Fluss Nam Khan in den Mekong fließt.
Postscriptum Januar 2025:
Die Stadt Luang Prabang mit ihren historischen Bauten ist seit 1995 UNESCO Weltkulturerbe. Heute besuchen viele Reisende die Stadt, obwohl Laos ein kommunistischer Staat ist. Der Aufenthalt in Laos ist nicht teuer. Im Moment entspricht 1 €uro etwa 23.000 laotischen Kip.
Laos ist flächenmäßig etwa so groß wie die alte Bundesrepublik Deutschland vor 1990. In Laos lebten 1974 aber nur etwa 3 Millionen Menschen. Laos war daher sehr viel dünner besiedelt als Deutschland. Es gab viel Landschaft und viel tropische Natur. Dazwischen gab es nur wenige kleinere Städte.
© Dr. Christian G. Pätzold, Januar 2025.

Zum Anfang
2025/01/06
Tagebuch 1974, Teil 78: Vientiane II (Laos)
von Dr. Christian G. Pätzold

Foto von Wakxy, 2008. Quelle: Wikimedia Commons.
17. Januar 1974, Vientiane, Donnerstag
Morgens waren wir im Krankenhaus wegen der Pickel, die sich bei mir gebildet hatten. Die Behandlung hat 300 Kip (1 DM) gekostet. Wir haben uns mit der Ärztin unterhalten. Sie hatte 9 Jahre in Moskau studiert, auch Leningrad hat ihr gefallen. Dann habe ich ein paar Postkarten nach Deutschland geschrieben und verschickt. Anschließend haben wir unsere Wiedereinreisevisa für Thailand bei der thailändischen Botschaft abgeholt. (Weiter in die Volksrepublik China zu reisen war nicht möglich. In China war ja noch immer Kulturrevolution. Die Weiterreise nach Vietnam war auch nicht möglich. Dort tobte immer noch der Vietnamkrieg.)
Schließlich haben wir noch die Flugtickets von Luang Prabang nach Ban Houei Sai für 9.000 Kip (30 DM) pro Person gekauft. Ban Houei Sai ist die laotische Stadt am Mekong und an der Nordgrenze von Thailand, wo wir wieder nach Thailand einreisen wollten.
Abends haben wir im Centre Culturel Français den Film »Yeah, Yeah, Yeah« (A Hard Day's Night) von den Beatles gesehen, einen Film über die frühen Jahre der bekannten Musikergruppe Beatles und die Beatlemania, den ich schon 1964 in Berlin gesehen hatte. Der Film ist ein sehr sehenswertes Dokument über die Atmosphäre im Swinging London der 1960er Jahre, die ich direkt mitbekommen hatte, da ich damals in London zu Besuch war. Auch ich war damals beeindruckt von den Songs der Beatles und hörte immer ihre neuesten Hits im Radio in den "Schlagern der Woche". Meist kletterten ihre Songs in der Hitliste auf Platz 1. Die Texte ihrer frühen Songs waren oft recht einfältig, aber die englische Sprache und der Beat ihrer Musik übten eine große Faszination aus.
Danach habe ich noch einen Brief von Zhou Enlai (Premierminister der Volksrepublik China, 1898-1976) über die chinesisch-indische Grenzfrage im Himalaya mit Landkarten gelesen. Das war ein lang anhaltender Konflikt, der zu häufigen Grenzscharmützeln führte und zur dauerhaften Vergiftung der Beziehungen zwischen China und Indien beigetragen hat.
18. Januar 1974, Vientiane, Freitag
Am Morgen sind wir zum Mekong gegangen, wo wir zwei arbeitslose Jungen getroffen haben, die in einem Wat wohnten und manchmal morgens von den Mönchen noch etwas Reis abbekamen, wenn sie Glück hatten. Die Tempel (Klöster) erfüllten hier teilweise die Funktion von Schulen, in denen in Lao unterrichtet wurde, während in den Regierungsoberschulen noch in Französisch unterrichtet wurde. Die Jungen sympathisierten mit der kommunistischen Pathet Lao, da deren "Psychologie" besser sei. Sie sagten, die Jugend sei für den Sozialismus. Wir haben ihnen etwas Essen spendiert.
Nachmittags um 3 Uhr hatten wir einen Termin bei einem Leiter der Nao Lao Hak Sat (NLHS, Laotische Patriotische Front). Ihr militärischer Arm war die Pathet Lao (Lao Patriotic Forces). Die NLHS war die wichtigste Massenorganisation der 1955 gegründeten Kommunistischen Partei. Die NLHS hatte mehrere Gebäude in Vientiane. Wir waren in dem Haus gegenüber der Britischen Botschaft, der Soldat am Eingangstor war höchstens 15 Jahre alt. Dort empfing uns Phao Boumaphol, Membre de la délégation des Forces Patriotiques au Comité Mixte Central d'execution des Accordes. Er hat uns die Geschichte und das Programm der NLHS erklärt. In den befreiten Gebieten von Laos werde in den Schulen in Lao unterrichtet, die Preise für Lebensmittel seien dort viel billiger, der ausländische Konsumterror sei gestoppt. Landenteignung von Großgrundbesitzern gäbe es nur in Sonderfällen, da viel Land vorhanden sei und Neuland verteilt werden könne. Er erzählte uns, dass er vor kurzem 2 Westdeutsche aus einer Künstlergruppe zu Besuch hatte. Eine Art DDR-Kola wurde uns von schüchternen Mädchen gereicht. Zum Schluss bekamen wir noch Bücher geschenkt. Er sagte uns, dass wir die befreiten Gebiete nicht besuchen könnten, da die Warteliste lang sei, hohe Funktionäre aus der Sowjetunion, Besucher vom Roten Kreuz etc. hätten Priorität.
Unser Gesprächspartner hat uns für den Abend zu einer Filmvorführung eingeladen. Der erste Film bestand aus Nationaltänzen und Liedern. Der zweite Film zeigte eine Akrobatengruppe in den befreiten Gebieten, die erstklassige Kunststücke vorführte. Es wurde auch eine Naturhöhle gezeigt, in der eine Textilfabrik mit 300 Arbeitern untergebracht war. Höhlen spielten im Befreiungskampf eine große Rolle, da sie einen Schutz vor den Bombardierungen durch die US-Flugzeuge boten.
Im Januar 1974 gab es also 3 militärische Akteure in Laos. Erstens die laotischen Regierungstruppen, die die alte Monarchie verteidigen sollten und von den USA unterstützt wurden. Zweitens die kommunistische Pathet Lao, die von der Sowjetunion, der Volksrepublik China und von Nord-Vietnam unterstützt wurde und schon weite Teile von Laos kontrollierte. Und drittens die US-amerikanische Luftwaffe, die Stellungen der Pathet Lao bombardierte. Die Motivationslage schien mir in etwa so: Die laotischen Regierungstruppen waren nicht sonderlich motiviert, für den König zu kämpfen. Die US-Regierung hatte auch kaum noch Lust auf den teuren Krieg in Indo-China. Nur die Pathet Lao war äußerst motiviert und hatte die junge Bevölkerung auf ihrer Seite.
(Anmerkung: Im Dezember 1975 übernahmen die Kommunisten in Laos die Macht und beendeten die Jahrhunderte alte Monarchie. Die Volksrepublik Laos wurde gegründet, die auch den Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 überdauerte.)
.
19. Januar 1974, Vientiane - Kasi, Sonnabend
Heute haben wir Vientiane verlassen, um die Hälfte der Strecke nach der alten Königsstadt Luang Prabang zu schaffen. Wir sind morgens zum Evening Market gegangen und haben den Bus nach Vang Vieng für 1.000 Kip (3 DM) genommen. Der Bus war knackig voll. Die Landschaft auf dieser Strecke ist noch verhältnismäßig flach, die Vegetation ist tropisch, man kommt durch viele Dörfer, deren Häuser aus Bambus gebaut sind. Von Vang Vieng sind wir mit dem Taxi ins benachbarte Kasi für 600 Kip (2 DM) gefahren. Dort haben wir in einem leeren Haus übernachtet.
© Dr. Christian G. Pätzold, Januar 2025.
Zum Anfang
2025/01/01
Das 3. Jahr des Ukrainekriegs (2024)
von Dr. Christian G. Pätzold
Was viele vor einem Jahr befürchtet hatten, ist leider eingetroffen. Der Krieg in der Ukraine zieht sich hin. Die russische Regierung besteht auf ihrer imperialen Größe. Und die Ukrainer bestehen auf ihrer Selbstbestimmung. Der Krieg in der Ukraine hat einen das ganze vergangene Jahr im Kopf beschäftigt. Durch die grauen Zellen spukten Drohnen, Raketen, Artillerie, Verletzte, Verstümmelte, Tote, Soldaten, Zivilisten. Es nahm kein Ende. Der russische Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung war pausenlos, und das schon über 1.000 Tage lang. Und dann kamen auch noch der Gaza-Krieg und der Libanon-Krieg hinzu. An allem war die deutsche Regierung mit massiven Waffenlieferungen beteiligt. Das war sehr beunruhigend. Nicht nur, weil es die deutsche Bevölkerung viele Milliarden Euro kostet, und die deutsche Bundesregierung zum Zusammenbruch geführt hat, sondern weil die deutsche Bevölkerung zur Zielscheibe wird. Die deutsche Politik steckt in diversen Dilemmata.
Anfang Februar 2024 hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Oberbefehlshaber der Armee Walerij Saluschnyj gefeuert und Oleksandr Syrskyj als Oberbefehlshaber eingesetzt. Als Gründe wurden die Erfolglosigkeit der ukrainischen Armee an der Front und die gescheiterte Großoffensive angegeben. Gleichzeitig haben die Republikaner im US-Kongress eine große Finanzhilfe für die Ukraine blockiert. Als Urheber hinter dieser Blockade wurde der ehemalige US-Präsident Donald Trump vermutet. Die amerikanische Finanzierung der Ukraine schien schwierig zu werden, denn die Amerikaner haben andere Interessen als die Europäer, die durch den Krieg direkter betroffen sind.
Am 16. Februar 2024 kam die Nachricht, dass der russische Staatsfeind Nr. 1 Alexej Nawalny in einem Straflager in Sibirien nördlich des Polarkreises gestorben war. Damit hatte Präsident Wladimir Putin nach Prigoschin einen weiteren Gegner beseitigt. Ende Februar musste die ukrainische Armee die Stadt Awdijiwka in der Region Donezk räumen, da der russische Druck zu groß geworden war. Der französische Präsident Emanuel Macron überlegte öffentlich, ob man westliche Bodentruppen in die Ukraine schicken sollte. So schien man Schritt für Schritt in einen 3. Weltkrieg hinein zu rutschen. Postwendend drohte Putin wieder mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gegen West-Europa. Die prorussischen Separatisten in Transnistrien haben Russland um Schutz gebeten.
Anfang März hat Papst Franziskus die Ukraine zur Kapitulation aufgefordert, um noch mehr Tote zu verhindern. Die Ukrainer dachten natürlich überhaupt nicht daran zu kapitulieren. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich weiter geweigert, den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern, da der Einsatz nur mit deutschen Soldaten möglich sei, die aber keine Kriegsteilnehmer in der Ukraine werden sollten. Am 17. März 2024 hat sich Präsident Putin für weitere 6 Jahre als Präsident von Russland wählen lassen, mit 87,3 % der Stimmen. Bedeutete das 6 weitere Jahre Krieg in der Ukraine?
Deutschland steckte tief in einem hybriden Krieg mit Russland, der viele Milliarden Euro verschlang. Aber das wurde der deutschen Bevölkerung nicht klar von der Bundesregierung gesagt, um die Bevölkerung nicht aus ihrer Komfortzone zu schrecken. Man spielte business as usual. Irgendwann bald musste es aber die deutsche Bevölkerung an ihrer Verarmung merken.
Seit Ende März 2024 sprach auch die russische Regierung offiziell von "Krieg" mit der Ukraine, und nicht mehr nur von einer "militärischen Spezialoperation".
Am 22. März 2024 ereignete sich ein großer Terroranschlag auf ein Popkonzert in Krasnogorsk nordwestlich von Moskau. Über 130 junge Menschen wurden ermordet. Es gab ein Bekennerschreiben des Islamischen Staates (IS), die russische Regierung sprach von einer Beteiligung der Ukraine. Der Vorfall zeigte, dass Putin wahrscheinlich auch Feinde im islamischen Lager hatte.
Am 8. April 2024 wurden die ersten deutschen Soldaten in Litauen stationiert. Die deutschen Soldaten sollen zu einer dauerhaften Brigade von etwa 5.000 Soldaten ausgebaut werden. Die Stationierung von deutschen Soldaten in Brigadestärke direkt an der russischen Grenze zu Kaliningrad ist offensichtlich eine große Provokation. Angesichts der deutschen Geschichte erscheinen vielen deutsche Soldaten in Ost-Europa sehr problematisch.
Anfang Mai kündigte Putin an, er wolle taktische Atomwaffen nahe der Ukraine testen. Das war der Auftakt zu seiner 5. Amtszeit als Oberhaupt von Russland. Das steigerte natürlich nicht gerade das Wohlbefinden in der Ukraine. Aus Kiew wurde gemeldet, dass Präsident Selenskyj den Chef seiner Bodyguards entlassen hat, da einige seiner Bodyguards einen Mordanschlag auf ihn verüben wollten. Und Russland startete eine Offensive in der Region Charkiw.
Präsident Putin will die Heilige Rus von imperialistischer Größe wiedererrichten, einschließlich der Ukraine, wozu er sich schon mal mit der mächtigen Volksrepublik China als Verbündeter angefreundet hat. Die USA und Deutschland wollen die Ukraine dagegen zu einem westlichen NATO-Land machen. Diese beiden Positionen sind unvereinbar. Und dazwischen steckt das arme Opfer Ukraine. In dieser Situation kann der Ukrainekrieg noch lange andauern, wenn es auch mal Kampfpausen geben mag. Die Niederlande zum Beispiel haben damals im 16. und 17. Jahrhundert einen 80-jährigen Krieg gebraucht, um ihre Unabhängigkeit vom Deutschen Reich zu erkämpfen.
Seit Anfang Juni durfte die Ukraine westliche Waffen auch gegen russisches Gebiet einsetzen, eine Eskalation des Krieges. Mitte Juni hatte Putin einen Waffenstillstandsplan vorgelegt. Seine Bedingungen waren: Die Ukraine sollte endgültig der vollständigen Abtretung der 5 Provinzen Luhansk, Donezk, Saporishia, Cherson und Krim an Russland zustimmen. Außerdem sollte die Ukraine auf einen Beitritt zur NATO verzichten und militärisch abrüsten. Diese Bedingungen wurden natürlich von der Ukraine postwendend abgelehnt.
Ende Juni gab es eine Debatte über die 1 Million nach Deutschland geflüchteten Ukrainer:innen. Von Seiten der CDU wurde kritisiert, die Ukrainer:innen würden nicht arbeiten wollen und sich stattdessen auf der Hängematte Bürgergeld ausruhen. Außerdem wurde gefordert, die Ukrainer:innen wieder in die West-Ukraine zurückzuschicken, da es dort sicher sei. Die Debatte war hauptsächlich rechtspopulistische Rhetorik für das deutsche Publikum, um der AfD das Wasser abzugraben.
Die russischen Gleitbomben, die von Flugzeugen abgeschossen wurden, waren für die Ukraine ein Problem, da sie kaum abgefangen werden konnten. Anfang August ist die ukrainische Armee erstmals in russisches Gebiet einmarschiert, in den Regionen Kursk und Belgorod. Das genannte Ziel war die Destabilisierung Russlands. Russland konnte die Gebiete nicht halten und musste viele Menschen vor der vorrückenden ukrainischen Armee evakuieren. Das machte deutlich, dass es Russland an Soldaten fehlte. Anfang September hat Putin die Nato-Staaten davor gewarnt, der Ukraine den Einsatz von westlichen Raketen gegen russisches Gebiet zu erlauben. Ein solcher Einsatz von Raketen würde bedeuten, dass Russland die NATO als Kriegsgegner betrachtet.
Putin setzte auf das Ausbluten der Ukrainer. In der ukrainischen Armee gab es viele Gefallene, außerdem viele Verletzte und Verstümmelte, deren amputierte Gliedmaßen durch Prothesen ersetzt werden mussten. Ende Oktober wurde vom ukrainischen Geheimdienst gemeldet, dass Soldaten aus Nord-Korea für Russland in der besetzten Region Kursk kämpfen sollen. Es wurde von 20.000 Soldaten aus Nord-Korea berichtet. Präsident Putin und der nord-koreanische Diktator Kim Jong-un sind schon leit längerem befreundet, wahrscheinlich auch weil Putin Atomwaffenwissen an Nord-Korea liefert. Die Zahl der bisher getöteten und verletzten russischen Soldaten wurde von der NATO mit 600.000 angegeben.
Am 5. November 2024 hatte Donald Trump von den Republikanern die US-Präsidentschaftswahl gegen Kamala Harris von den Demokraten gewonnen. Er hatte angekündigt, die finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine zu beenden. In diesem Fall würden enorme zusätzliche Kosten auf die Europäer zukommen, wenn die Ukraine weiter im Krieg gegen Russland unterstützt werden sollte. Einen Tag später, am 6. November 2024, ist in Deutschland die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP zerbrochen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen, der schon vorher häufig gegen die eigene Koalition geschossen hatte. Gründe für das Ampel-Aus waren vor allem die Kosten des Ukrainekriegs, verschiedene Ansichten zur Schuldenbremse im Grundgesetz, die Talfahrt der deutschen Wirtschaft und das absehbare Scheitern der FDP an der 5-Prozent-Hürde bei den nächsten Wahlen. Im Januar 2025 wollte Olaf Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen, Neuwahlen waren für März 2025 geplant. Dann wurde die Vertrauensfrage auf Dezember 2024 vorgezogen und Neuwahlen für Februar 2025 geplant.
Am 17. November 2024 hat US-Präsident Joe Biden den Einsatz von US-Raketen weit in russischem Gebiet erlaubt, um russische Militäranlagen auszuschalten, von denen russische Raketen auf die Ukraine abgefeuert werden. Die russische Seite hat postwendend mit dem Beginn des 3. Weltkriegs gedroht.
Anfang Dezember 2024 erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj, die Ukraine wäre zu einem Waffenstillstand bereit, wenn die von Russland unbesetzten Gebiete der Ukraine unter Nato-Schutz gestellt würden.
Zum Schluss noch eine Anmerkung zum diesjährigen Hintergrundbild von www.kuhlewampe.net: Zu sehen sind rosafarbene Räucherstäbchen, zum Trocknen aufgestellt im Dorf Quang Phu Cau in der Nähe von Hanoi/Vietnam, nachdem sie in die Räucherlösung getaucht wurden. Das Foto ist von September 2022, Fotograf ist Trantuanviet. Quelle: Wikimedia Commons. Das Foto ist Bild des Jahres 2024 bei Wikimedia Commons. Mein Rat: Ein Räucherstäbchen anzuzünden ist ok. Aber zu viele Räucherstäbchen erzeugen zu viel Feinstaub, das sollte man vermeiden.
© Dr. Christian G. Pätzold, Januar 2025.
Zum Anfang